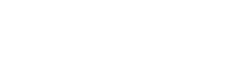Im Vorfeld der Wahlen befindet sich Deutschland im wirtschaftlichen Krisenmodus. In der Autostadt Zwickau sind die Auswirkungen zu spüren. Gewerkschaften und Politiker suchen nach einem Rezept zur Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und rechtsextremen Stimmungen.
Reportage von Constanze Letsch, erschienen in De Groene Amsterdammer vom 20. Februar 2025 Jahrgang 149/8

Im niederländischen Magazin De Groene Amsterdammer ist eine Reportage erschienen von der Journalistin Constanze Letsch. Thema war die wirtschaftliche Lage in Deutschland vor der Bundestagswahl im Februar 2025, sowie die hiesige Debatte über eine „antifaschistische Ökonomie“. Die Autorin sprach dafür unter anderem mit mir. Sie stellte mir freundlicherweise die deutsche Fassung zur Verfügung, um sie hier online verfügbar zu machen.
Es ist kurz nach zwölf im Volkswagen-Werk Zwickau, der viertgrößten Stadt in Sachsen. Auf dem Gelände herrscht Geschäftigkeit, man hört das Surren von Maschinen, Autoteile werden verladen, auf einem Parkplatz stehen nagelneue Wagen, allesamt E-Autos, die auf ihren Abtransport warten. Ein paar Mitarbeiter stehen vor der Kantine und rauchen.
Alles wie immer, könnte man meinen. Doch der Schein trügt. Die grauen Wolken, die an diesem Januartag über den Werkhallen hängen, passen zur Stimmung. Vor wenigen Wochen kündigte die VW-Spitze massive Gewinneinbußen und eine mögliche Schließung des Werkes in Zwickau an. Zwar konnte die Gewerkschaft IG Metall diesen Schritt nach mehrtägigen Verhandlungen abwenden, doch der Unmut bei den Beschäftigten ist geblieben. „Hier glaubt doch keiner mehr dran, dass es wieder besser wird“, sagt ein Mitarbeiter, Anfang 50, der seinen Namen lieber nicht nennen will. „Wir werden doch nur noch verarscht.“
Deutschland scheint aus dem Krisenmodus nicht mehr herauszukommen. Drohende Massenentlassungen, Gewinneinbrüche, Insolvenzen und ein ständiges Händeringen der Industrie füllen die Schlagzeilen. Die deutsche Wirtschaft ist bemerkenswerte zwei Jahre in Folge geschrumpft und auch für 2025 sagen Prognosen nur ein sehr bescheidenes Wachstum voraus. Die Arbeitslosenquote steigt, die erwarteten Steuereinnahmen sinken. Deutliche Kaufkraftverluste durch eine hohe Inflation schüren Angst und Unsicherheiten bis weit in die Mittelschicht hinein. Die Probleme in der Automobilindustrie, dem mit Abstand größten Industriezweig des Landes und Stützpfeiler des deutschen Exportmodells, tragen zusätzlich zur Krisenstimmung bei.
Es ist bemerkenswert, dass die schwächelnde Wirtschaft trotz alledem im Wahlkampf kaum eine Rolle spielt. Einige Kommentatoren vermuten, dass man mit den nun nötigen unschönen Maßnahmen bei den Wählern eben nicht punkten könne. Dabei hatten die etablierten Parteien kurz nach dem Zerbrechen der Regierungskoalition noch einen Wirtschaftswahlkampf angekündigt. Auch marktliberale Lobbygruppen wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) fordern mit alarmistischen Kampagnen und in Anlehnung an die Wahlversprechen der konservativen CDU und der liberalen FDP eine radikale Deregulierung, Bürokratieabbau, niedrigere Lohnkosten, Steuersenkungen für Unternehmen und weniger Geld für Sozialausgaben. Sollten diese Maßnahmen nach der Wahl durchgesetzt werden, so warnen progressive Ökonomen und Politikwissenschaftler, riskieren sie aber nicht nur eine Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme, sondern auch einen weiteren Rechtsruck und ein Erstarken der rechtsextremen AfD.
Eine interessante Debatte löste die renommierte Ökonomin Isabella Weber mit einem Tweet im November aus, als sie nach dem Wahlsieg von Donald Trump eine „antifaschistische Wirtschaftspolitik“ für Deutschland vorschlug. Die Inflation und die damit verbundenen rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten hätten in den USA einen entscheidenden Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt, erläuterte sie später im Podcast Lage der Nation. Für Deutschland, so Weber, sollte das amerikanische Wahlergebnis „eine absolute Warnung“ sein. Eine weitere „Umverteilung von unten nach oben“, wie sie zum Beispiel der ehemalige Finanzminister Christian Lindner vorsieht, sei die falsche Antwort auf die prekäre wirtschaftliche Lage in Deutschland und das Gefühl vieler Menschen, sich grundlegende Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr leisten zu können.
Wer den Rechtspopulisten wirklich die Stirn bieten wolle, müsse zugunsten eines sozialen Ausgleichs in den Markt eingreifen.
Wer den Rechtspopulisten wirklich die Stirn bieten wolle, müsse zugunsten eines sozialen Ausgleichs in den Markt eingreifen: mit Preiskontrollen zum Beispiel bei der Miete, bei Energiekosten und bei Lebensmitteln, mit Übergewinnsteuern und einer staatlichen Industriepolitik für eine grüne Transformation der Wirtschaft, die auch einkommensschwache Haushalte finanziell unterstützt und jeden mitreden lässt.
Damit umreißt die Ökonomin, die schon durch ihren erfolgreichen Vorschlag zu Energiepreisbremsen bekannt geworden ist, einen Plan zur Absicherung gegen Krisenerfahrungen, einen zeitlich begrenzten „ökonomischen Katastrophenschutz“, wie Weber es nennt. Denn gerade Abstiegsängste sind nachweislich ein Nährboden für rechte Ressentiments. Ein starker Staat, der Menschen in Krisenzeiten nicht einfach „dem Markt“ überlässt, könne den Zusammenhalt in einer Gesellschaft wiederherstellen und wachsende Ungleichheiten zwischen armen und reichen Menschen verringern. Damit würde rechten Diskursen zumindest teilweise das Wasser abgegraben.
In Zwickau ist man von der Politik im Moment vor allem enttäuscht. Eine Anstellung beim europagrößten Autohersteller Volkswagen stand zumindest in Deutschland lange für Arbeitsplatzsicherheit, solide Tarifverträge und eine starke Gewerkschaftsbindung. Damit es nun vorbei. „Das Vertrauen ist weg“, konstatiert Kristin Oder, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Volkswagen Sachsen. Die Ankündigung einer möglichen Werkschließung im September habe der Belegschaft den Boden unter den Füßen weggerissen. „Viele Kollegen schenken den Aussagen des Unternehmens keinen Glauben mehr.“

Mit den geplanten Kürzungen wolle VW wieder international wettbewerbsfähig werden, so die Konzernleitung. Vor allem der Absatz von Elektroautos im derzeit wichtigsten Markt, China, sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch in Zwickau, wo seit 2020 ausschließlich E-Autos montiert werden, laufen Teile des Werks wegen der geringen Auslastung schon seit November 2023 nur noch im Zweischichtbetrieb. Nun verliert Zwickau den Bau fast aller elektrischen Modelle an VW-Werke in Niedersachsen. Bleiben soll nur der Audi Q4 e-tron. Die Verträge von 1000 befristet Beschäftigten laufen bis zum Sommer aus, 1000 weitere Mitarbeitende mussten bereits gehen.
In Gewerkschaft und Betriebsrat ist man trotzdem zufrieden, zumindest die Schließungen vorerst abgewendet zu haben. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, so Martin Lehmann, Referent des Betriebsrates bei Volkswagen Sachsen. Immerhin sei der Standort Zwickau für die nächsten fünf Jahre gesichert. Doch der Schock sitzt bei allen noch immer tief. Mit rund 9400 Beschäftigten ist das VW-Fahrzeugwerk Zwickau der größte Arbeitgeber der Stadt und mit hunderten von Zuliefererbetrieben der wichtigste der Region. Zehntausende Menschen und ihre Familien wären von einer VW-Schließung betroffen. Der Dominoeffekt wäre fatal, sagt Lehmann: „Da hängt alles dran – der Bäcker, der Elektrofachmarkt, alle. Die ganze Region lebt von der Kaufkraft, die die Automobilindustrie in die Region bringt.“ Es gäbe unter Kollegen, Familie und Bekannten kaum noch ein anderes Thema als die Krise bei Volkswagen.
„Wenn VW zumacht, wird Zwickau zur Geisterstadt. Das wird hier wie in Detroit“, sagt Jens Juraschka, SPD-Bundestagskandidat in Zwickau. Aber ja, der Konzern habe Fehler gemacht. „Zum Beispiel hätten sie kleine, bezahlbare Elektroautos anbieten müssen. Auch die Stadtverwaltung, die Pflege und andere öffentliche Dienste haben Flotten mit kleinen Fahrzeugen. Die haben keine VWs. Als Zwickauer ärgert mich das.“ Er selbst fährt einen elektrischen Skoda, der von der VW-Tochtergesellschaft in Tschechien gebaut wird.
„Wir haben so viel verschlafen“, sinniert er und entschuldigt sich sofort belustigt, sich unbewusst mit VW und der deutschen Wirtschaft identifiziert zu haben. „Das geht einem hier ins Blut über.“ Doch er meint nicht nur die Industrie. Auch die Politik habe die Entwicklungen schlicht verpasst, und das schon lange vor dieser Regierung. „Überall bröckelt es – beim Personennahverkehr, bei den Schienen, bei den Brücken, bei der gesamten Infrastruktur.“ Auch der Ausbau des Stromnetzes sei viel zu langsam vorangeschritten. „Deutschland erzeugt viel billigen Strom selbst, durch Windenergie zum Beispiel. Aber wir kriegen den Strom nicht von Nord nach Süd!“
Untersuchungen haben gezeigt, dass die marode Infrastruktur in vielerlei Hinsicht die Wirtschaft ausbremst. Kaputte Straßen, baufällige Brücken und damit zusammenhängende Staus werden zunehmend zu einem wichtigen Risikofaktor für Industrie, Transportunternehmen und Handwerk. Trotz lauter Kritik sowohl aus progressiven und konservativen Kreisen hielt der ehemalige FDP-Finanzminister Christian Lindner jedoch an der Schuldenbremse fest. Diese im Grundgesetz festgeschriebene Regelung besagt, dass eine staatliche Neuverschuldung 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten darf.
Es muss wieder weh tun, ins Auto zu steigen.
Eigentlich müsse man sich sowieso wieder viel mehr auf den öffentlichen Verkehr konzentrieren, ihn von der Straße zurück auf die Schiene holen, findet Juraschka. Ob man das in Zwickau laut sagen dürfe? Er lacht. „Natürlich. Es muss wieder weh tun, ins Auto zu steigen! Diesen ständigen Fokus auf Individualmobilität können wir uns als Gesellschaft gar nicht leisten.“
Seit mehr als hundert Jahren werden in Zwickau Autos gebaut und weiterentwickelt. Hier hat die Marke Audi ihre Wurzeln und hier baute ihr Gründer, der Ingenieur August Horch, erstmals serienmäßig Fahrzeuge mit Linkslenkung, damit Fahrer den entgegenkommenden Verkehr besser sehen konnten. Zuvor wurden Lenkräder stets rechts montiert, da früher die Kutscher auf der rechten Straßenseite lieber den Graben im Blick behielten. Ab 1955 wurde hier in einem volkseigenen Betrieb (VEB) aus Baumwolle und Kunstharz der ostdeutsche „Trabant“ produziert. Und als die Mauer fiel, übernahm Volkswagen das Werk, um dort Trabis mit VW-Motoren zu montieren. Doch dazu kam es nicht mehr. Stattdessen bauten die gut ausgebildeten Ingenieure und Fachkräfte 1993 den VW-Golf und wenige Jahre später den VW-Passat. Die Arbeitslosigkeit in der Region, die kurz nach Wende die Marke von über 20 Prozent überstieg, liegt heute bei kaum fünf Prozent und damit unter dem Bundesdurchschnitt.
„Fast jeder hier hat in der Familie oder im Freundeskreis jemanden, der auf irgendeine Art für VW arbeitet oder über Zulieferer mit dem Konzern zu tun hat“, sagt Christian Henneberg. Der gelernte Kfz-Mechatroniker, der seit fünf Jahren im Montage-Finish arbeitet, hat den Umbruch von der Verbrennerautoherstellung zu Elektroautos mitgestemmt, hat die Corona-Pandemie und die Halbleiterkrise miterlebt. „Wir haben die Transformation unter widrigsten Bedingungen erfolgreich gemeistert. Zwickau hat immer geliefert. Das weiß auch die Konzernspitze.“
Als hier am 4. November 2019 das erste E-Auto vom Band lief, war die Stimmung noch eine ganz andere. Der Wolfsbuger Konzern hatte sich den Umbau des Werkes in Zwickau 1,2 Milliarden Euro kosten lassen und der damalige Volkswagen-Chef Herbert Diess versprach bei der Eröffnung, „Deutschland zum Leitmarkt der Elektromobilität zu machen“. Bundeskanzlerin Angela Merkel rühmte Zwickau als „Flaggschiff des Wandels in der Automobilindustrie“.
„Damals haben sich alle in dem Licht unserer Leistungen gesonnt“, sagt Martin Lehmann verbittert. Die Kommunalpolitik bemühte sich, möglichst viele Zulieferer für Elektromobilität in der Region anzusiedeln. Zahlreiche Fachkräfte kündigten teilweise feste Arbeitsverträge anderswo, um als hoffentlich nur vorerst befristete Angestellte von den ambitionierten E-Mobilitätsplänen im VW-Werk zu profitieren. Viele von ihnen werden nun gehen müssen. Zwar habe das Management viele Fehler gemacht, sagt Kristin Oder, aber es fehle auch ein konsequenter und vorausschauender politischer Kurs, um die Mobilitätswende voranzubringen. Förderungen seien willkürlich abgeschafft worden und noch immer fehle es an der nötigen Infrastruktur für Elektroautos. Ihre Kollegen nicken zustimmend. „Die Politik hat sich verabschiedet“, meint Lehmann.
Das deutsche Wirtschaftsmodell sei völlig voraussehbar gegen eine Wand gefahren, schreibt der Journalist Wolfgang Münchau in Kaput: The End of the German Miracle. Die Abhängigkeit von billigem russischem Gas, der Fokus auf exportorientiertes Wachstum und viel zu langsame Digitalisierung seien Deutschland zum Verhängnis geworden. Die deutsche Autoindustrie und die Politik hätten die Mobilitätswende und geopolitische Verschiebungen auf dem Weltmarkt schlicht verschlafen. „Doch warum müssen diese Fehler jetzt von der Belegschaft ausgebadet werden?“ fragt Oder.
Diese Frage ist nicht von der Hand zu weisen, doch wird sie in den derzeitigen Forderungen der Konzernspitze, man müsse nun „zusammenstehen“, diskursiv unschädlich gemacht. Im November nannte VW-Personalchef Gunnar Kilian den geplanten Sparkurs „eine historische Weichenstellung“, für die die Beschäftigten bereit sein müssten, „Einschnitte hinzunehmen“. Auch der Finanzvorstand Arno Antlitz verteidigte die Sparpläne damit, dass es die „gemeinsame Verantwortung“ aller Beteiligten sei, Volkswagen für „kommende Generationen wettbewerbsfähig“ aufzustellen. Unerwähnt bleibt bei diesem Anrufen an einen konzerninternen Gemeinschaftssinn, dass Volkswagen im letzten Jahr noch 4,5 Milliarden Euro Gewinne an Aktionäre ausschütten konnte und über 147 Milliarden Euro an Gewinnrücklagen verfügt. Der Konzern ist trotz einbrechender Verkaufszahlen noch immer profitabel, wenn auch die Margen kleiner sind als in vergangenen Jahren. Diese von einer höheren Kapitalrendite motivierten Verzichtsforderungen an die Belegschaft klingen in Zeiten massiv gestiegener Lebenshaltungskosten, wachsender ökonomischer Unsicherheiten und einer immer größeren Ungleichheit zumindest provokativ.
Diese Dissonanz kann in einer Gesellschaft zu schweren Verwerfungen führen, so lautet das Argument der Ökonomin Isabella Weber. Wenn Menschen arbeiten und sich trotzdem Sorgen machen müssen, ob sie ihre Einkäufe und Rechnungen bezahlen können, drohe der Gesellschaftsvertrag und damit das Vertrauen in das System in die Brüche zu gehen.
Diese Verunsicherung hilft vor allem der AfD: Zur Europawahl im letzten Jahr bekam die rechtsextreme Partei in Zwickau fast 35 Prozent aller Stimmen. Selbst im Zwickauer Betriebsrat tun sich Risse auf. Bei der letzten Betriebsratswahl im Januar konnte das rechte „Bündnis freier Betriebsräte“ um den AfD-Lokalpolitiker Jörg Reichenbach seine Mandate gegenüber der IG Metall auf vier Sitze verdoppeln. Die Strategie dieser Gruppierung sei ähnlich wie die der AfD, sagt Kristin Oder: „Sie machen viel Propaganda, bieten aber keinerlei Lösungen an. Vor einem Vierteljahr sind sie noch durchs Werk gerannt und haben behauptet, die E-Mobilität sei an allem schuld. Sie wollten die Verbrenner zurück.“
Schon seit Jahren versuchen rechtspopulistische und rechtsextreme Bündnisse auch in anderen Automobilwerken und Betrieben, etablierte Gewerkschaften zu unterwandern. Bei Daimler-Benz, bei BMW und Porsche konnte eine solche Gruppe Mandate gewinnen. „Die provozieren und polarisieren“, sagt der Mechatroniker Christian Henneberg über das Bündnis in Zwickau. „Die nutzen die Situation, in der viele Mitarbeiter Ängste haben und unsicher sind, gezielt aus. So wie es Populisten eben immer tun.“
Jens Juraschka tritt zur Bundestagswahl an, um dem Rechtsruck entgegenzuwirken. Dazu bräuchte es ein umfassendes Konjunkturpaket, Investitionen in die Infrastruktur und einen starken Sozialstaat. Kinderarmut und vor allem auch Altersarmut seien große Probleme in der Region. „Den Grund dafür kann ich in zwei Worte fassen: Niedriglohnland Sachsen.“
In der Nachwendezeit wurden westdeutsche Unternehmen mit dieser marktliberalen Politik in den Osten gelockt. Wer sich in der ehemaligen DDR ansiedelte und investierte, konnte nicht nur mit großzügigen Subventionen rechnen, sondern profitierte auch vom Wegfall von Tarifverträgen und der Verwässerung weiterer arbeitsrechtlicher Errungenschaften, die in Westdeutschland längst etabliert waren. In der Folge ist die Tarifbindung in der ganzen Bundesrepublik seit Mitte der 1990er Jahre drastisch gesunken, was gleichzeitig zu einem Lohnrückgang führte. Sie liegt nun bei rund 50 Prozent, wobei sie in Ostdeutschland noch deutlich niedriger ist als im Westen. Doch nirgendwo ist die Lage so prekär wie in Sachsen, wo laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 2019 noch nicht einmal 40 Prozent der Beschäftigten in einem tarifgebundenen Betrieb arbeiteten.
Der Niedriglohnsektor wurde noch dazu durch die sogenannten Hartz-Reformen der Nullerjahre gestärkt, die großen Druck auf Erwerbslose ausübte, Arbeit auch zu schlechten Bedingungen und in prekären Beschäftigungsverhältnissen anzunehmen, wo Niedriglöhne stark verbreitet sind. Eva Völpel, Referentin für Wirtschafts- und Sozialpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weist im Podcast Armutszeugnis darauf hin, dass exportorientiertes Wachstum, das in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaftspolitik maßgeblich bestimmt, auf niedrige Löhne und Sozialabgaben angewiesen ist, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.
Auch wenn die Zahlen in den letzten Jahren unter anderem durch die bundesweite Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 wieder rückläufig sind, hat Deutschland mit 16 Prozent noch immer in einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. „Das ist volkswirtschaftlich völlig unrentabel. Es bremst die Kaufkraft und den Wohlstand bei uns“, sagt Juraschka. Gerade Sachsen habe jahrelang mit Niedriglöhnen um Investitionen und Unternehmen geworben. Auch in Zwickau sind die negativen Folgen dieser Wirtschaftspolitik deutlich. „Jetzt haben wir 35 Jahre seit der Wende und schon jede Menge Rentner in Altersarmut“, erläutert er. So liege die Rente zahlreicher Menschen in der Region weit unter der derzeitigen Armutsgrenze von 1250 Euro im Monat. „Auch der Mindestlohn ist noch viel zu niedrig. Der sichert gerade mal das Existenzminimum, mehr nicht.“
Wer trotz Arbeit oder Rente mit seinem Einkommen unterhalb des Existenzminimums bleibt, hat Anspruch auf Aufstockung bis zur Grundsicherung. „Völlig absurd“, findet Juraschka. „Wir lassen Menschen zu den schlimmsten Konditionen arbeiten und in der Rente muss der Staat dann alles abfangen.“ Im Grunde würde die miese Lohnpolitik von Unternehmen damit ja durch Steuern subventioniert.
Auch die Sparpolitik müsse endlich ein Ende haben. „Die Schuldenbremse geht zulasten der nächsten Generation“, sagt der Kommunalpolitiker. „Natürlich können wir ihr auch ein Land mit lauter eingestürzten Brücken, verrotteten Schulen und einer vollkommen maroden Infrastruktur hinterlassen. Zumindest hätten wir dann fein gespart.“ Es sei schwer, bei diesem Thema nicht zynisch zu werden. „Wir müssen wir den jungen Leuten doch zeigen, dass wir in sie investieren!“
Dabei sei durchaus genug Geld da, es sei nur falsch verteilt, zitiert er den 2017 verstorbenen CDU-Politiker Heiner Geißler. „Wir haben ein ganz massives Verteilungsproblem“, fährt Juraschka fort. „Vor allem seit der Pandemie sind die Armen immer ärmer, und die Reichen immer reicher geworden. Dabei kennen wir alle Steuersparmodelle und wissen, wo die Briefkästen in Panama und Liechtenstein hängen.“ Es müsse endlich die 1997 ausgesetzte Vermögenssteuer zurückgeholt werden. „Die Menschen, die das meiste besitzen, müssen auch am meisten zur Kasse gebeten werden, um die Struktur aufrechtzuerhalten. Diese Strukturen helfen ja auch ihnen dabei, ihre Gewinne zu erwirtschaften.“
Obwohl eine große Mehrheit in Deutschland Themen wie Vermögensumverteilung und Steuergerechtigkeit als wichtig ansieht, sehen fast alle Wahlprogramme Steuererleichterungen für Unternehmen und reiche Menschen vor.
Obwohl eine große Mehrheit in Deutschland Themen wie Vermögensumverteilung und Steuergerechtigkeit als wichtig ansieht, sehen fast alle Wahlprogramme Steuererleichterungen für Unternehmen und reiche Menschen vor. Gespart wird wieder bei denen, die sowieso schon wenig haben.
Wenige Meter vor der Auffahrt zum VW-Werk in Zwickau hat die CDU ein Wahlplakat aufgestellt mit dem Slogan: „Fleiss muss man wieder im Geldbeutel spüren.“ Jens Juraschka winkt ab. „Ich kann die Sprüche von ‚harter Arbeit‘ und ‚mehr Leistung‘ nicht mehr hören! Da werden die Wähler veralbert. Wir wissen doch, wer das Geld hat und wer woran verdient“, sagt er aufgebracht. „Deutschland kann sich eine weitere Verschlechterung des Sozialstaates nicht leisten. In was für einem Land wollen wir denn leben?“
In den letzten Jahren häufen sich wissenschaftliche Studien, die einen engen Zusammenhang zwischen Austeritätspolitik und einem Erstarken rechter Parteien nachweisen. Doch die marktliberale Politik, die der AfD zum Aufstieg verholfen hat, würde sich unter einer von Friedrich Merz geführten Regierung noch verschärfen. Dies ist ein Grund, warum der Vorschlag zu einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik links auf viel Resonanz gestoßen ist. Die Partei Die Linke hat sie sogar zum Kern ihres Wahlprogramms gemacht.
Die von Weber vorgeschlagenen Maßnahmen seien „vollkommen richtig“, sagt die Journalistin und Politologin Sabine Nuss. „Doch sie greifen zu kurz.“ Durch die Verflochtenheit der Märkte und den internationalen Wettbewerb, der seit der Globalisierung und verschärften weltweiten Deregulierung der 70er und 80er Jahre dazu führte, dass sich Länder auf Kosten von Arbeitsrechten und Natur gegenseitig herunterkonkurrierten, seien die Vorschläge Webers – wie zum Beispiel Preiskontrollen – für einzelne Staaten allein schwer durchzusetzen. Deswegen sei es wichtig, jede einzelne Maßnahme unter dem Hinblick der „nationalen Machbarkeit abzuklopfen“.
Parallel dazu „müsste man gemeinsame Mindeststandards und Sozialstandards entwickeln – zumindest einen europäischen Mindestlohn oder einen globalen Mindestlohn.“ Das klinge zwar alles nach Utopie, lacht Nuss. Aber müsse man die unangefochtene Idee der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit“ nicht sowieso grundsätzlich problematisieren? Denn dieser Wirtschaftsnationalismus biete nicht nur ein starkes Narrativ für die Rechte, sondern spiele auch Arbeiter international gegeneinander aus. „Wir hören ständig und jeden Tag nur, dass ‚wir‘ den Wettbewerb gewinnen müssen. Aber keiner sagt: Können wir mal damit aufhören?‘“ Eine wirklich antifaschistische Wirtschaftspolitik dürfe nicht länger darauf gerichtet sein, andere im ständigen Wettbewerb überflügeln und damit letztendlich ruinieren zu wollen. „Man könnte träumen und sich eine Wirtschaft vorstellen, die nicht immer zu irgendwelchen schlimmen Krisen führt, bis hin zu Handelskriegen“, so Nuss.
Träumen in der Zeit der gramscianischen Monster? Warum nicht.
Träumen in der Zeit der gramscianischen Monster? Warum nicht. Die gegenüber progressiven Vorschlägen immer wieder ins Feld geführte vermeintliche „Alternativlosigkeit“ des kapitalistischen Wirtschaftssystems führt zu einem Gefühl der Ohnmacht und des Kontrollverlustes, was Studien zufolge rechte Ressentiments schürt. Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung von 2023 zeigt, dass mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz zu einem Rückgang rechtsextremer Überzeugungen führt, insbesondere bei Islamophobie und Ausländerfeindlichkeit.
Deswegen müsse eine antifaschistische Wirtschaftspolitik auch eine Wirtschaftsdemokratisierung beinhalten, erläutert Nuss. Gerade bei staatlich hoch subventionierten Unternehmen müssten Beschäftigte und die Zivilgesellschaft ein größeres Mitspracherecht erhalten, argumentiert sie. „Staatliche Förderungen müssten an Auflagen wie gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne und eine echte sozialökologische Transformation gebunden sein.“ Das sei ein radikaler Vorschlag, weil er die Interessen der Kapitalgeber in den Hintergrund stelle. „Aber es wäre immer noch viel sinnvoller, als wieder staatliche Verluste und private Gewinne in Kauf zu nehmen.“ Auch die Vergesellschaftung von Unternehmen sei eine Möglichkeit.
Ähnliche wirtschaftsdemokratische Ideen existieren in unterschiedlichen Formen bereits. Als das britische Unternehmen GKN den Autozuliefererbetrieb im italienischen Florenz schloss und den mehr als 400 Beschäftigten per E-Mail kündigte, besetzte die Belegschaft kurzerhand die Fabrik und versucht nun, die Produktion als Genossenschaft auf Lastenfahrräder und Photovoltaikanlagen umzustellen. Von dort aus schickten die italienischen Genossenschaftler auch eine Solidaritätsbekundung zu ihren Kollegen nach Zwickau, wo das GKN Gelenkwellenwerk Ende letzten Jahres geschlossen und die rund 800 Beschäftigten auf die Straße gesetzt wurden. „Wir können euch nur raten, Gemeinschaft und solidarisch zu sein, nur gemeinsam seid ihr stark“, hieß es in der Botschaft. „Was sie dem einen antun, wird irgendwann alle anderen auch erreichen.“
Die Zwickauer im VW-Werk wollen sich nicht einfach geschlagen geben. „Das muss hier wieder werden“, sagt Gewerkschaftler Martin Lehmann. „Die Politiker, die jetzt gewählt werden, müssen sich der Verantwortung für dieses Land und die Menschen hier bewusst sein. Und zwar für alle.“