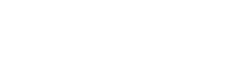Die Erinnerung daran, dass vor dem Kapitalismus anders gewirtschaftet wurde, lässt für die Zukunft hoffen. Aus OXI 12/22.
Von Stephan Kaufmann und Sabine Nuss
Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus«, lautet ein berühmtes Zitat des Kulturwissenschaftlers Fredric Jameson. Eine Alternative zum herrschenden Wirtschaftssystem scheint unmöglich. Gestützt wird diese Annahme durch die Darstellung des Kapitalismus als etwas Ewiges: So wie es ist, ist es immer schon gewesen, und daher wird es auch immer so bleiben. Ihren analytischen Niederschlag findet diese Weltanschauung in sogenannten Rückprojektionen und Naturalisierungen, die die nicht-kapitalistische Vergangenheit entlang scheinbar überhistorischer Kategorien ordnen: Wirtschaft, Effizienz, Eigentum, Kosten, Nutzen, Knappheit – im Grunde, so die Botschaft, ist alles gleich geblieben. Auch die Schweine sind es.
In einem Blogbeitrag hat sich der Historiker Peter-Alexander Kerkhof von der Universität Leiden einem eher extravaganten Thema gewidmet: der Darstellung des Hausschweins in Computerspielen, deren Handlung im Mittelalter spielt. Die Dörfer in »Medieval Dynasty«, »Foundation«, »Assassin’s Creed: Valhalla« seien bevölkert von rundlichen Ebern und Säuen mit rosa Haut und Stummelbeinen. Sogar in visuellen Schmuckstücken wie »A Plague Tale: Innocence«, das im Frankreich des 14. Jahrhunderts spiele, sähen die Schweine aus wie ihre heutigen Gegenstücke. Es sei allerdings sehr gut belegt, dass das mittelalterliche Hausschwein ganz anders gebaut war: Es war eher klein, stand auf länglichen Beinen, der Rücken war gebogen, die Schnauze lang und mit Hauern versehen. »Vor allem war das Schwein absolut nicht nackt und rosa«, vermerkt Kerkhof, »sondern von langem, dunklem Haar bedeckt.«
Dargestellt in den Computerspielen wird es aber analog zum modernen Industrieschwein, dessen Physiognomie von seiner kapitalistischen Rentabilität bestimmt wird. Durch gezielte Zucht sind schnell wachsende und sich schnell vermehrende Tiere entstanden, die aufgrund ihres Gewichts auf kurzen kräftigen Beinen stehen müssen. Schließlich sollen sie viel und qualitativ möglichst hochwertiges Fleisch ansetzen – bei gleichzeitig möglichst niedrigem Futterverbrauch.
Dass diese passgenau für ihre Verarbeitungsziele kreierten Tiere im Mittelalter ebenso existiert haben, davon gehen die Designer:innen von Computerspielen offensichtlich aus. Sie halten das heutige Schwein für eine Naturkonstante. Fehlerhaft dargestellt wird laut Kerkhof nicht nur der Körper der Schweine, auch deren mittelalterliches Leben. Auf dem Computerbildschirm wälzen sie sich in Ställen oder wandern durch die Dörfer. Tatsächlich aber lebten die Tiere damals nicht im Dorf, sondern wurden auf Gemeindeland gehalten – auf Brachflächen oder in Wäldern. Die »Waldhut« war eines der wesentlichen fixierten Rechte der Dorfgemeinschaft. Dies änderte sich erst, als Wälder und andere Gemeindeflächen langsam verschwanden und das Hausschwein zu einem Lebewesen wurde, das auf dem Hof des Bauern sein Dasein fristete.
Die fehlerhafte Verpflanzung moderner Mastschweine in mittelalterliche Dörfer ist nur eine Anekdote. Sie bebildert aber ein verbreitetes Denkmuster, nach dem aktuelle Zustände schon früher anzutreffen waren. Nicht nur Schweinephysiognomien werden von heute aus in die ferne Vergangenheit rückprojiziert. Auch die ökonomischen Determinanten ihrer Bewirtschaftung – und überhaupt des mittelalterlichen Wirtschaftssystems. Auch damals, so die Annahme der Property-Rights-Theorie, lagen der Ökonomie dieselben Strukturen wie heute zugrunde: Die Wirtschaftssubjekte strebten danach, ihren individuellen »Nutzen« zu maximieren. Gleichzeitig waren die Nutzen spendenden Güter – gemessen an den grenzenlosen Bedürfnissen – immer »knapp«. »Effizienz« bedeutete auch damals, dass das nutzenmaximierende Verhalten der Wirtschaftssubjekte zu einer Steigerung des Ausstoßes führt.
Diese drei Annahmen führen die Property-Rights-Theorie zu dem Schluss, dass kollektiv – also nicht privatwirtschaftlich – bewirtschaftete Gemeingüter (»Allmenden« wie Fischgründe oder Weideland) ineffizient sind. Denn wenn eine Gruppe von Leuten eine Ressource gemeinsam bewirtschaftet und niemand von der Nutzung dieser Ressource ausgeschlossen werden kann, dann können Einzelne ihren individuellen Nutzen maximieren, ohne für die gemeinschaftliche Verbesserung der Ressource zu sorgen. Handeln alle Individuen so, erleidet die Ressource Schaden, eine Übernutzung ist die Folge. In der Sprache der Ökonomen: Das rational handelnde nutzenmaximierende Individuum handelt paradoxerweise so, dass am Ende ein kollektiv irrationales Ergebnis steht. Per Saldo profitiert niemand.
Bekannt ist dies als »Tragik der Allmende« (Garrett Hardin), aus der das Lob des modernen Privateigentums folgt, das den Nutzen aller maximieren soll. »Wenn die Subsistenzmittel im Gemeineigentum stehen, so gibt es wenig Anreiz zum Erlernen einer besseren Technik oder zum Erwerb größeren Wissens«, schrieb der US-Ökonom Douglass North. »Exklusive Eigentumsrechte, die dem Eigentümer etwas einbringen, bieten einen unmittelbaren Anreiz zur Erhöhung von Effizienz und Produktivität.« So erklärt North den »raschen Fortschritt, den die Menschen in den letzten 10.000 Jahren im Unterschied zu ihrer langsamen Entwicklung in der langen Zeit des primitiven Jagens und Sammelns davor verzeichneten«.
Noch heute wird diese Anreiztheorie des Privateigentums herangezogen, um die Überlegenheit des Kapitalismus nicht nur gegenüber dem Feudalismus zu erklären, sondern auch gegenüber dem realsozialistischen Ostblock. Allerdings hat diese Theorie eine Reihe schwerer Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass sie historisch besondere Gegebenheiten als überhistorische »ewige« Kategorien darstellt. Zum Beispiel das Eigentum. So kennt North im Grunde nur zwei Zustände: einen mit »gesicherten« oder »effizienten« Eigentumsrechten und einen anderen mit »nicht gesicherten« oder »weniger effizienten Eigentumsrechten«. Eigentum selbst ist ihm eine offensichtlich überhistorische Institution. Dabei bezeichnete Eigentum im Mittelalter mitnichten die Macht ausschließlicher Verfügung über die Sache. Bis in das 19. Jahrhundert hinein war im größeren Teil Europas der Boden der entscheidende Produktionsfaktor, aber es gab kein Bodeneigentum im Sinne des modernen Eigentumsbegriffs, das heißt einer zum Ausschluss Dritter berechtigenden willkürlichen Verfügungsgewalt. Eigentum in vorkapitalistischen Epochen war ein anderes soziales Verhältnis als das Privateigentum heute. Das erscheint North aber nicht als erklärungsbedürftig. Vielmehr subsumiert er die verschiedenen historischen Eigentumspraxen nivellierend unter einen einzigen Begriff (»gesicherte Eigentumsrechte«) und stellt damit das heutige Privateigentum als natürlich dar. In unreflektierter Weise wird die konkrete, gegenwärtige Vergesellschaftungsform für allgemeingültig gehalten und entsprechend historisch rückprojiziert.
Diese Naturalisierung findet sich auch bei der »Tragedy of the Commons«. Zwar hat Hardins Theorie in der Volkswirtschaftslehre durchaus Kritik gefunden, am prominentesten durch die Ökonomin und Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom. Sie untersuchte, wie Gemeingüter kollektiv bewirtschaftet werden können, ohne dass es zu einer Übernutzung der Naturressourcen kommt. An den Modellen der Mainstream-Ökonomen, die nur staatliche oder Marktlösungen kennen, kritisierte Ostrom, dass in ihnen unabänderliche Bedingungen gesetzt sind. Jenseits der statischen Spielregeln der abstrakten ökonomischen Modelle aber stellten sich soziale Organisationsformen in der Praxis als durchaus variabel dar: Menschen können miteinander reden. Sie können verhandeln, planen, Parzellen, Wasserrechte oder Fanggebiete zuteilen, sich über Regeln einig werden, die Regeln überwachen und zu kollektiven, produktiven Lösungen kommen.
Mit ihrer Kritik machte Ostrom zwar den Blick frei dafür, dass es jenseits von Marktmechanismen und staatlicher Zuteilung Formen von Selbstorganisation gibt, die nachhaltig und produktiv sind. Die Grenzen ihrer Erklärung liegen aber da, wo sie bei der dominanten Wirtschaftswissenschaft generell liegen, die von sich behauptet, nicht ein bestimmtes Wirtschaftssystem zu untersuchen, sondern »die Wirtschaft« an sich. Kennzeichen dieser Wirtschaft soll eine prinzipielle »Knappheit« an Gütern sein. Dass Güter »knapp« sind, gemessen an den unbegrenzten Bedürfnissen der Menschen, mag sich plausibel anhören. Ist es aber nicht. Denn Orangensaft ist in dieser Lesart immer knapp, unabhängig davon, wie viel Orangensaft es gibt, wie viel man davon produzieren könnte und wie viele Menschen überhaupt danach dürsten. Im Mittelalter dagegen dürfte in Europa keine Knappheit an Orangensaft existiert haben, da die Menschen nichts davon wussten.
In der Realität misst sich »Knappheit« immer am Vergleich mit den tatsächlich vorhandenen Bedürfnissen und den vorhandenen Ressourcen zu ihrer Befriedigung. Nur wer die Bedürfnisse als »unendlich« definiert, landet bei einer prinzipiellen Knappheit, die allerdings nicht existiert. Auffindbar sind dagegen historisch spezifische Knappheiten: im Mittelalter eher bedingt durch mangelnde Naturbeherrschung und unterentwickelte Produktionstechnik. Im Kapitalismus dagegen dient gerade das Privateigentum dazu, Menschen von den Mitteln ihrer Bedürfnisbefriedigung auszuschließen, wodurch Güter knapp gemacht werden, damit sie nur im Tausch gegen Geld erhältlich sind – und dem Eigentümer dadurch einen Profit einbringen. Diese spezifische Knappheit wird durch die Annahme eines prinzipiellen Mangels naturalisiert und zum Schicksal gemacht.
In den volkswirtschaftlichen Modellen erscheint die kapitalistische Gesellschaft der Gegenwart nicht als eine historisch besondere Form von Gesellschaft, die es erst seit einigen hundert Jahren gibt und die spezifische Merkmale aufweist. Umgekehrt werden früheren Wirtschaftssystemen Eigenschaften angedichtet, die offensichtlich dem Kapitalismus entstammen. So versuchen die Hirten bei Hardin, per se so viel Vieh wie möglich auf die allen frei zugängliche Weide zu schicken, damit sie ihren Erlös aus dem Verkauf der Tiere maximieren können, zulasten des Weidegrundes. Dass das Ziel der Hirten ein möglichst hoher Verkaufserlös ist, gilt allerdings nicht für vorkapitalistische Epochen, in denen Subsistenz vorherrschte.
Auch Ostrom, ganz dem ahistorischen Herangehen der bürgerlichen Ökonomie verhaftet, entgeht, dass Hardins Modell eindeutig Züge einer kapitalistischen Gesellschaft trägt, in der sich der Tausch von Ware und Geld als dominierende Verkehrsform durchgesetzt hat und in der daraus folgend »Nutzen« eine sehr spezielle Bedeutung und Eigentum eine sehr spezielle Funktion hat. Privateigentum, wie wir es heute kennen, ist ausschließendes Eigentum an Produktionsmitteln (Maschinen, Fabrikgebäude, Rohstoffe, Werkzeug, etc.), über deren Verwendung eine Minderheit bestimmt. Dabei ist für kapitalistisches Eigentum kennzeichnend, dass die Produktionsmittel eingesetzt werden, um unter den Bedingungen von Konkurrenz aus vorgeschossenem Kapital mehr Kapital zu machen. Die Naturstoffe, die im Produktionsprozess verarbeitet werden, sind ebenso wie die menschliche Arbeitskraft nur Mittel, um mehr Kapital generieren zu können, als man für ihren Kauf investieren musste.
Der gesellschaftlich dominante Zweck ist der Profit, der sich bloß quantitativ bemisst und dessen Vermehrung daher maßlos ist: Seine Dynamik findet kein Ende »an sich selbst«, er ist nie genug. Diese historisch spezifische Dynamik wird naturalisiert als Bedürfnis zur endlosen »Nutzenmaximierung«, aus der die spezielle »Rationalität« des den eigenen Nutzen maximierenden Homo oeconomicus resultiert. »Effizient« ist entweder, wenn der Ausstoß möglichst hoch ist, oder wenn ein gegebener Ausstoß mit möglichst geringem Input produziert wird. Erkennbar ist hier weniger die menschliche Natur oder das ewige Gesetz des Wirtschaftens, sondern die kapitalistische Kalkulation, die auf die Maximierung der Differenz zwischen Erträgen und Kosten zielt. Das Ergebnis ist nicht Effizienz, sondern Rentabilität. Und das Mittel dazu ist die Ausbeutung von Mensch und Natur, deren Kehrseite die Untergrabung ihrer eigenen Grundlagen ist.
Die gängige Kritik am Homo oeconomicus – dass der Mensch doch eigentlich ganz anders sei, sozial, irrational, uninformiert, selbstlos … – übersieht, dass mit seiner Konstruktion ein ganz anderes Ziel verfolgt wird, nämlich die Gesetze des Kapitalismus in der Menschennatur zu verankern. Dabei ist am Kapitalismus nichts menschlich und nichts ewig. Er hatte Vorgänger. Und vielleicht hat er einen Nachfolger. Und in dem sehen die Schweine wahrscheinlich wieder anders aus.