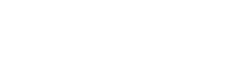Beim Wort Enteignung denken wir schnell, uns würde etwas weggenommen. Dabei ist Gemeineigentum ein Gewinn für alle.
Erschienen in Zeitschrift LuXemburg, Februar 2022
Im Sommer 2021 setzte die Verfasserin dieses Artikels im Nachrichtendienst Twitter einen Tweet mit folgendem Inhalt ab: »#Privateigentum abschaffen heißt übrigens nicht, jemandem etwas wegnehmen, sondern allen etwas geben.« Dieser Tweet löste einen Shitstorm aus, über Nacht sprang der Hashtag #Privateigentum auf Platz eins der Deutschlandtrends, die meisten Bezugnahmen waren aggressiv, häufig beleidigend. Man solle doch der »stalinistischen Chefenteignerin« die Klamotten vom Leib reißen, hieß es da, ihr Portemonnaie enteignen, ihr Auto, sie solle ihre IBAN rausrücken. Einer lud sich zum Frühstück ein und mutmaßte, der volkseigene Kühlschrank sei ja sicher voll. Hunderte von Nachrichten dieser Art fluteten die Timeline der Verfasserin, einer der erbosten Nutzer fragte: »Heißt das, ich kann Ihnen ihr Auto, Fahrrad, Möbel wegnehmen? Weil Privateigentum ist ja schnöde. Lasst andere arbeiten, sich Dinge kaufen, und dann sollen sie es hergeben? Für Schmarotzer, Schnorrer, die selber nichts auf die Reihe bringen? Nein danke, ich behalte mein Eigentum.«
Zwei Reaktionen, die auch aus der hitzigen Debatte um die Kampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« vertraut sind, tauchten gehäuft auf: die Unterstellung, weil man Privateigentum kritisiere, wolle man zum real existierenden Sozialismus zurück, hätte gar Stalinismus zum Ziel, und die Angst, man wolle einen um das persönliche Eigentum bringen.
Diesen Befürchtungen liegt ein bestimmtes Verständnis von Eigentum zugrunde. Zum einen wird die Ordnung, die auf Privateigentum beruht, als Voraussetzung einer freien Marktwirtschaft wenn nicht für die beste, so doch im Vergleich zum real existierenden Sozialismus für die bessere aller möglichen Welten gehalten. Dieser Vorstellung zufolge hat in der Wettbewerbsgesellschaft jeder und jede die Freiheit, kraft seiner oder ihrer Anstrengung privat für sich Eigentum anzuhäufen. Implizit wird davon ausgegangen, dass es die eigene Arbeit sei, die Eigentum schafft. Diese in die Literatur als »Arbeitstheorie des Eigentums« eingegangene Grundannahme ist auch Basis der herrschenden Leistungsideologie. Wenn man die Früchte seiner Arbeit erntet, so die Überzeugung, kann man entsprechend viele Früchte ernten, wenn man viel arbeitet. Im Umkehrschluss: ohne Fleiß kein Preis.
Je sozial ungleicher Gesellschaften nun werden, je mehr sich der Reichtum in nur wenigen Händen konzentriert, die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, desto härter ist der Kampf um das eigene Hab und Gut, der in einer Wettbewerbsgesellschaft ausgefochten werden muss – um Arbeitsplätze, um Aufstiegschancen. Kritik an Privateigentum wird dann deshalb so vehement zurückgewiesen, weil einem das unter diesen Bedingungen immer härter erarbeitete Eigentum besonders verteidigungswürdig erscheint. Auch der feindliche Individualismus, der die herrschende Eigentums- und Wettbewerbsordnung prägt, nimmt dann zu.
Dieses Eigentumsdenken ist kennzeichnend für das öffentliche Bewusstsein. Es ist allerdings nur oberflächlicher Schein eines sehr viel tiefer reichenden gesellschaftlichen Verhältnisses. Seine Analyse stellt die grundlegenden Vorannahmen der herrschenden Eigentumsideologie nicht nur auf den Kopf, sie zeigt darüber hinaus, warum dieses Denken so wirkmächtig ist: Schuld daran sind nicht (allein) die Gedanken der Herrschenden, die zu den Gedanken der Beherrschten werden, vielmehr ist es eine spezifische Alltagspraxis, in der wir alle gefangen sind, die die skizzierten Annahmen zu Eigentum nahelegt und damit den davon ausgehenden feindlichen Individualismus erzeugt. Das soll im Folgenden erläutert werden.
Produktives und persönliches Eigentum
Eigentum, das gibt uns der spontane Alltagsverstand auf, scheint allein aus dem bürgerlichen Recht erklärbar. Demnach haben wir uns Regeln gegeben, wobei eine der wichtigsten und verfassungsrechtlich verankerten das Recht auf Eigentum ist. Das meint: das Recht, andere vom Zugang zu einer Sache ausschließen zu dürfen und mit dem Inhalt nach Belieben zu verfahren. Diese juristische Seite ist durchaus eine zentrale Dimension des Eigentums, aber bei Weitem nicht seine einzige. Das wird deutlich, wenn man einen historischen Blick auf Eigentum wirft.
Generell und alle historischen Zeiten übergreifend gilt: Um als Gesellschaft zu überleben, müssen sich Menschen Natur aneignen, damit sie Nahrung haben und sich vor den Witterungen schützen können. Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, all das sind Ergebnisse der Aneignung von Natur oder: die Früchte der Arbeit. Die Aneignung von Natur setzt voraus, dass über sie verfügt werden kann. Dabei ist es ein gewaltiger Unterschied, ob über die Mittel verfügt wird, mit denen die Natur angeeignet wird (Werkzeuge, Maschinen) oder ob darüber verfügt wird, was mit diesen Mitteln aus der Natur produziert wird. Wenn zwei Personen vor einem Apfelbaum stehen, es aber nur eine einzige Leiter gibt (und die Leiter die einzige Möglichkeit ist, an einen Apfel zu kommen), dann ist klar, dass jene Person ohne Leiter auf Gedeih und Verderb auf den Goodwill der Person mit Leiter angewiesen ist. Die Person mit Leiter kann die Person ohne Leiter schlicht verhungern lassen.
Man kann, was im öffentlichen Diskurs selten getan wird, diese beiden Objekte der Verfügung – Leiter/Baum und Apfel – analytisch unterscheiden in: Produktionsmittel (Pflücken) oder produktives Eigentum auf der einen Seite und Konsumtionsmittel (Essen) oder persönliches Eigentum auf der anderen. Diese Unterscheidung macht Sinn, weil exklusive Verfügungsgewalt über Produktionsmittel eine wesentlich größere Macht verleiht als jene über Konsumtionsmittel. Im Kern der Kritik an Privateigentum steht daher auch nicht persönliches Eigentum wie die Zahnbürste oder der Kühlschrank, sondern das, was ihrer individuellen Aneignung überhaupt erst vorausgeht: die Art und Weise ihrer Herstellung. Wie sich nun aber Menschen in einer Gemeinschaft zueinander bezüglich ihrer Produktionsmittel verhalten, darin unterscheiden sich die historischen Epochen voneinander.
Die Entstehung des Privateigentums: Trennung in Besitz und Eigentum
Die Herausbildung der modernen Marktwirtschaft, wie wir sie heute kennen, war daher auch eine Veränderung der Art und Weise, wie Menschen zueinander und zu den Mitteln der Aneignung von Natur in Beziehung stehen. Boden war noch bis vor etwa 500 Jahren das wichtigste Produktionsmittel überhaupt. Im Rahmen spezifischer persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse (Leibeigenschaft) hatten die sozial untergeordneten Menschen unmittelbar Zugang zum Boden und lebten wesentlich von der Subsistenzwirtschaft, das heißt von den Früchten des Landes, das sie beackerten und bewohnten.
Erst mit der massenhaften Vertreibung der Landbewohner*innen von ihrem Boden, beginnend mit dem Ausgang des Mittelalters bis weit in das 19. Jahrhundert hinein (»Einhegungen«), entstand das, was wir heute moderne Marktwirtschaft oder Kapitalismus nennen. Die Menschen waren nun zwar aus ihrer feudalen Herrschaftsbeziehung befreit und wurden dank bürgerlicher Revolution zu einem Subjekt mit gleichen Rechten, aber sie standen da ohne Boden, Baum und Leiter und damit ohne Zugangsmöglichkeit zum Apfel. Wenn sie nicht verhungern wollten, mussten sie sich ins Benehmen setzen zu jenen, die Leiter und Bäume hatten. Das taten sie, indem sie ihnen ihre Arbeitskraft verkauften. Sie entwickelten sich daher historisch von Fronarbeitenden zu Lohnarbeitenden. Damit veränderte sich das in jener Zeit herrschende Bewusstsein von Aneignung. Erst jetzt schälten sich zwei Kategorien so trennscharf heraus, wie wir sie heute kennen: Besitz und Eigentum.
Besitz ist die tatsächliche, konkrete Verfügungsgewalt, Eigentum die rechtliche, abstrakte Verfügungsgewalt. Man kann Eigentümer*in sein, ohne das Eigentumsobjekt im Besitz zu haben, und man kann etwas besitzen, ohne Eigentümer*in des Besitzes zu sein. (Beispielsweise ist eine Mieterin zwar Besitzerin der Wohnung, aber nicht Eigentümerin. Bei Selbstnutzer*innen fällt Eigentum und Besitz in eins).
In ihrer historisch neuen sozialen Rolle sind die ehemaligen Leibeigenen daher auch wieder im Besitz von Produktionsmitteln – so, wie sie früher ihr Produktionsmittel Land bearbeiteten, so bedienen und benutzen sie auch in der modernen Fabrik die Produktionsmittel. Aber sie besitzen sie nur, sie haben keine abstrakte, rechtliche Verfügungsgewalt über sie. Die haben die Eigentümer*innen der Produktionsmittel und sie geben daher auch die Art und Weise der Verwendung vor. Diese besteht im Wesentlichen darin, das von den Privateigentümer*innen vorgeschossene Kapital zu vermehren.
Wer sich genauer anschaut, wie diese wunderliche Kapitalvermehrung zustande kommt, wird die eingangs erwähnte Annahme, Arbeit begründe Eigentum – Grundbaustein des herrschenden Eigentumsdenkens – plötzlich in einem anderen Licht sehen: Die Lohnarbeitenden müssen unter dem Kommando der Privateigentümer*innen etwas produzieren, das mehr Wert hat, als sie selbst für ihren Lebensunterhalt bekommen. Ein Beispiel: Der abhängig Beschäftigte Peter baut in einer Fahrradfabrik fünf Fahrräder. Die Eigentümerin der Fahrradfabrik, Caroline, eignet sich alle fünf Fahrräder an. Peter bekommt kein einziges. Peters Arbeit schafft gar kein Eigentum für Peter. Peters Arbeit schafft Eigentum für Caroline. Caroline zahlt Peter nun zwar einen Lohn, der liegt aber systematisch und nicht zufällig unter dem Wert der fünf Fahrräder. Caroline verkauft alle fünf Fahrräder (wennʼs gut geht) und sackt die Differenz ein zwischen dem, was Peter kriegt, und dem, was sie für alle Räder bekommen hat. Das ist der Mehrwert, von dem sich ein Teil als Carolines Gewinn in der Bilanz niederschlägt. Und was bleibt Peter? Der Lohn, den er für seine Arbeit erhält. Er ermöglicht ihm über den Umweg des Marktes den Zugriff auf einen Ausschnitt des von allen Arbeiter*innen unter diesem Kommando produzierten Reichtums. Aber dieser Anteil entspricht nur dem, was Peter braucht, um seine Arbeitskraft erhalten zu können, sodass er weiterhin in der Lage ist, für Caroline Fahrräder zu bauen. Peters Einfluss darauf, was er konsumieren kann, das heißt Art und Umfang seines persönlichen Eigentums, ist daher quantitativ als auch qualitativ fremdbestimmt. Qualitativ ist er abhängig davon, was der Markt nach Kriterien der Profitmaximierung hergibt, und quantitativ davon, was er sich mit dem Lohn leisten kann. Mit Peters Freiheit ist es unter diesen Bedingungen also nicht weit her. In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Peter vom eigentumslosen Besitzer zum Eigentümer von Produktionsmitteln aufsteigt, um dann auch andere für sich arbeiten lassen zu können. Aber: »Vom Tellerwäscher zum Millionär« ist nur der Traum, der Menschen wie Peter glauben lässt, dass es jeder schaffen kann. Es ist damit ein weiterer Mythos des oben skizzierten Eigentumsdenkens entlarvt: Menschen wie Peter werden sich noch so anstrengen können: Der Preis für seinen Fleiß – der Lohn seiner Arbeit – bleibt in aller Regel begrenzt auf persönliches Eigentum. Über die Produktionsmittel hat er keine Verfügungsmacht.
Die Trennung der Mehrheit der Menschen von der Verfügungsgewalt über das produktive Eigentum macht sich dann am schmerzlichsten bemerkbar, wenn ihre Arbeitskraft nicht mehr oder nicht ausreichend rentabel ist. Denn das Verhältnis jener, die über das produktive Eigentum verfügen, zu diesem Eigentum und zu jenen, die damit arbeiten, ist rein instrumentell: Mensch und Natur werden einzig und allein dazu eingesetzt, das dafür investierte Kapital zu vermehren. Unternehmen produzieren darüber hinaus unabhängig voneinander in Konkurrenz für einen anonymen Markt. Sie wissen also nie, ob sich ihr Kapital verwertet, ob die eingekaufte Arbeitskraft sich gelohnt hat. Daher ist das produktive Eigentum auch »Privat«eigentum: Es ist nicht der öffentlichen demokratisch legitimierten Verfügung zugänglich und wird nicht in transparenter Abstimmung der Unternehmen untereinander kooperativ produziert, sondern isoliert, unter Geheimhaltung, auf eigene Rechnung.
Diese Praxis birgt ein enormes Potenzial für regelmäßig ausbrechende Krisen und setzt die Arbeitenden außerhalb ihrer Kontrolle stehenden und ihnen als quasi natürlich erscheinenden Marktbewegungen aus. Das kann sich zeigen als Lohnsenkung, als Preissteigerung, im schlimmsten Fall als Arbeitslosigkeit. Dann ist die Trennung der Arbeitenden vom gesellschaftlich produzierten Reichtum vollständig durchgesetzt, der Zugang zu konsumtivem Eigentum bricht jäh ab und man wird zum Bittsteller gegenüber dem Staat.
Freiheit, Gleichheit, Eigentum
Für die Akteure in der modernen Marktwirtschaft stellt sich Wirtschaft nun allerdings ganz anders dar als hier analysiert, nämlich als ein großer neutraler und harmloser Zusammenhang von Kaufen und Verkaufen, eine Praxis – der Markt –, die es vermeintlich immer schon gegeben hat. Es wird nicht unterschieden, ob Arbeitskraft, Produktionsmittel oder Konsumgüter getauscht werden. Alles ist sich gleich darin, eine Ware zu sein. In diesen millionenfachen Tauschakten treten sich die Besitzenden von Waren und die Besitzenden von Geld ebenso als rechtlich Gleiche gegenüber.
Als Tauschende folgen sie ihrem freien Willen, sie gehen Verträge freiwillig mitei-
nander ein: Kaufverträge, Miet- oder Leihverträge, aber auch Arbeitsverträge, bei denen Arbeitskraft gegen Lohn getauscht wird. Es ist dies eine ganz spezifische Freiheit, die die bürgerliche Gesellschaft kennzeichnet, es ist die Freiheit des Marktindividuums. Als frei erscheint sie im Gegensatz zur persönlichen Unfreiheit vergangener Epochen, wo nicht der Verkauf der Arbeitskraft zwischen zwei rechtlich gleichen Subjekten die Regel war, sondern persönliche Abhängigkeit, wie zum Beispiel Sklaverei und Leibeigenschaft.
Betrachtet man lediglich die millionenfachen Tauschakte und abstrahiert von der Produktionssphäre, so scheint eigene Arbeit der Grund für Eigentum zu sein, weil im Tausch in der Regel Produkte getauscht werden, die das Ergebnis von Arbeit sind. Geld zum Tauschen verdient man sich durch Arbeit. Güter oder Dienstleistungen entstehen durch Arbeit. Wenn ich etwas tausche, ist das Eigentum daran längst geklärt, es ist dem Tausch vorausgesetzt. Was getauscht wird, gehört juristisch dem Tauschenden, sonst könnte er es nicht tauschen, es sieht also im Tauschakt so aus, als seien Arbeit und Eigentum eine Einheit. Der Zwischenschritt, die Aneignung fremder Arbeit, die Abschöpfung des Mehrwerts, ist unsichtbar. So scheint es unmittelbar einleuchtend, dass Art und Umfang persönlichen Eigentums auf die jeweils eigene Arbeit zurückzuführen sind.
Diese Perspektive wird durch die alles prägende Praxis des alltäglichen ubiquitären Tauschs Ware gegen Geld nahegelegt. Auf diese Weise tritt nur das freie, gleiche Subjekt, das potenziell eigentumsfähig und daher seines Glückes Schmied ist, an die Oberfläche. Das Herrschaftsverhältnis bleibt im Verborgenen. Das ist die Folie, vor der das herrschende Eigentumsdenken seine Annahmen trifft und entsprechende Blüten treibt.
Aufhebung des Privateigentums
Die Aufhebung des Privateigentums würde nun bedeuten, im Rahmen gesellschaftlicher Kämpfe um einen neuen Produktionszweck zu ringen, mit dem Ziel, ihn zugunsten von Mensch und Natur zu verändern. Ganz im Sinne der hier vorgelegten Analyse des Eigentums wäre das in letzter Konsequenz die Aufhebung der Privatproduktion. Dazu müssten jene Arbeitenden, die zwar die tatsächliche und konkrete Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel innehaben (Besitz), aber nicht die rechtliche und abstrakte (Eigentum), für die Aneignung des Letztgenannten kämpfen. Hätten die Besitzer*innen der Produktionsmittel wirkliche Verfügungsmacht darüber, könnten sie auf den Zweck ihres Unternehmens Einfluss nehmen, nicht im Sinne einer besseren Kapitalverwertung durch Arbeiterhand, sondern im Sinne einer neuen, alle Unternehmen übergreifenden und transparenten, abgestimmten und kooperierenden Produktionsweise. Die Beschäftigten würden nicht nur gemeinsam im Betrieb, sondern – in gesellschaftliche Debatten eingebettet und rückgekoppelt – darüber entscheiden, wie sie das produktive Eigentum einsetzen. Das übergeordnete Ziel wäre nicht mehr die Maximierung des Profits, sondern die Verbesserung aller Arbeits- und Lebensbedingungen, die Emanzipation von der Unterordnung unter den privat orchestrierten Wachstumszwang. Eine solche Einführung von Demokratie in die Sphäre der Wirtschaft sollte keinesfalls mit Verstaatlichung verwechselt werden, da der moderne Nationalstaat selbst angewiesen ist auf Einnahmen aus Kapitalverwertung (Steuern) und damit auf das Florieren genau jenes Produktionszwecks, der gerade verändert werden soll. Role model sind eher genossenschaftliche Modelle oder Kooperativen, non-profit-orientierte Betriebe und Organisationen. Sie müssten sich mehr und mehr vernetzen, viral werden und zum hegemonialen Gesellschaftsmodell avancieren. Erst damit würden öffentliche und private Interessen aufhören, einen Gegensatz zu bilden. Es geht daher nicht um persönlichen Besitz: Privateigentum abschaffen bedeutet nicht, jemandem etwas wegnehmen, sondern allen Menschen etwas geben, nämlich Verfügung über einen gesellschaftlichen Bereich, über den sie bislang keinerlei Kontrolle haben, der vielmehr Kontrolle über sie hat. Es gäbe eine Welt zu gewinnen: die Befreiung aus dem Arbeits- und Wachstumszwang dieser Wirtschaft und die Wiederaneignung der Verfügungsgewalt über die Lebensbedingungen, kurz: Freiheit und Eigentum für alle statt nur für eine privilegierte Klasse.