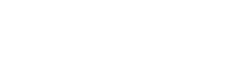Die Idee, die Reichen hätten ihren Reichtum verdient, ist schon alt und war noch nie richtig
Erschienen am 29. März 2021 in OXI, Wirtschaft anders denken
Regelmäßig listen Medien die reichsten Menschen der Welt auf. So auch vor einigen Wochen die »FAZ«. In ihrer Liste fanden sich an der Spitze Elon Musk (Vermögen 183 Milliarden Dollar), Jeff Bezos (182 Milliarden) und Bernard Arnault (146 Milliarden). Zusätzlich wurden die Leser über drei Dinge informiert: die Nationalität des Milliardärs, seine Branche und ob er sein Vermögen bloß geerbt oder »selbst erarbeitet« hat. Die Logik: Was nicht geerbt ist, ist wohl selbst erarbeitet – und damit wohlverdient.
Reproduziert wird damit die Annahme, den Reichen stehe ihr Reichtum auch zu, außer im Erbfall: »Der größte Teil des Vermögens in Deutschland wurde nicht durch der eigenen Hände Arbeit, sondern durch Erbschaften erzielt«, kritisiert Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Die Idee, die Reichen hätten ihren Reichtum mit harter Arbeit verdient, hat Tradition. Ihr Vater war der englische Philosoph John Locke, ein Mann, der mitten in der historischen, nicht ganz friedvollen Entstehung von Privateigentum gelebt hat. Zu seiner Zeit bedurfte individuelles Eigentum noch der Rechtfertigung. Denn eigentlich, so das damals akzeptierte Naturrecht, habe Gott die Erde den Menschen zur gemeinsamen Verfügung gegeben, eine individuelle Aneignung war daher nicht vorgesehen. Dagegen hielt Locke: Es ist die eigene Arbeit, die das Recht auf Eigentum begründet. Zur exklusiven Verfügung aneignen darf man die Früchte der eigenen Arbeit, weil der Körper einem selbst gehört: Pflücke ich den Apfel von einem Baum, vermische ich physisch die Natur mit meiner Körperkraft. Was immer also der Mensch, so Locke, »dem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen und in dem sie es belassen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und ihm etwas eigenes hinzugefügt. Er hat es somit zu seinem Eigentum gemacht.«
Unter der Arbeit des Eigentümers verstand Locke, ganz Kind seiner Zeit, auch die Arbeit anderer. »Das Gras, das mein Pferd gefressen, der Torf, den mein Knecht gestochen, und das Erz, das ich an irgendeiner Stelle gegraben, […] wird auf diese Wiese mein Eigentum ohne die Anweisung oder die Zustimmung irgend jemandes«, schrieb er. Damit schlug er Pferd und Knecht der Person des Eigentümers zu und rechtfertigte die private Aneignung mit einem als natürlich vorausgesetzten Herrschaftsverhältnis: mein Pferd, mein Knecht. Auch wenn die Leibeigenschaft inzwischen abgeschafft ist, so gilt es bis heute den »Arbeitgebern« als selbstverständlich, dass ihnen die Produkte der Arbeit »ihrer« Beschäftigten gehören.
Mit seiner Theorie schaffte Locke einen Doppelschlag: Er legitimierte das moderne Eigentum und führte dieses gleichzeitig auf die Leistung des Eigentümers zurück. Aus seiner trickreichen Konstruktion resultiert bis heute die Annahme, der Mensch werde nur dann tätig, wenn er die Früchte seiner Arbeit sein Eigen nennen darf. Geboren war damit die sogenannte Anreiztheorie individuellen Eigentums.
Lockes Theorie führt heutzutage zum einen zur zuweilen hemmungslosen Feier erfolgreicher »Unternehmerpersönlichkeiten«, deren Reichtum auf ihren herausragenden Fähigkeiten beruhen soll. Dieser Personenkult animiert das Publikum zur Frage »Wie hat der das bloß gemacht?«. »Die Musk-Methode«, titelte jüngst das »Manager-Magazin«. Zum anderen dient die Anreiztheorie der Feier des Kapitalismus. Dass er eigene Anstrengung mit Einkommen und Vermögen belohnt, gilt als seine Stärke – und als die entscheidende Schwäche des Realsozialismus. »1. Ich leiste was, 2. Ich leiste mir was«, stand 1981 in großen Lettern auf einem Plakat, das die Sozialistische Einheitspartei der DDR zu ihrem 10. Parteitag in Druck gegeben hatte. Es war ein Aufruf an die Werktätigen. Man wollte in ihrem »Denken und Handeln« durchsetzen, dass die »Leistungskraft« jedes Einzelnen die der ganzen Gesellschaft ausmacht. Geholfen hat es nicht. Acht Jahre später fiel die Mauer.
Schuld am Scheitern der sozialistischen Planwirtschaft, so die herrschende Lesart, war die Verfassung des Eigentums: Wo die Produktionsmittel dem Staat gehören, da helfen auch Parteiappelle nichts. Es fehlt der individuelle Anreiz zur Leistung – »ohne Preis kein Fleiß«. So liest sich die Ideologie der Ordnung, die auf Privateigentum ruht, fast wie ein cleverer Schachzug: Garantiert man den Menschen die Früchte ihrer Arbeit, gibt man ihrem nutzenmaximierenden Egoismus Raum, so entfaltet sich die Motivation von ganz alleine. Davon profitiert am Ende die ganze Gesellschaft. Und in der Tat: Während im Sozialismus eine umfangreiche Belobigungsstruktur die Werktätigen zur Arbeit motivieren sollte – »Straße der Besten«, »Aktivist der sozialistischen Arbeit«, Orden, Medaillen, Urkunden und dergleichen –, erledigt die Marktwirtschaft das quasi im Vorbeigehen. Es scheint die effizientere Variante.
Besser als in die Werkhallen der VEB scheint das SED-Plakat in die Vorstandsbüros der heutigen Vermögensmillionäre zu passen. Die 1,5 Prozent reichsten Menschen in Deutschland sind im Wesentlichen Eigentümer von Unternehmen und Immobilien. Und haben sie es nicht verdient? Eine Studie des DIW rechnete jüngst vor, dass Vermögensmillionäre im Schnitt 46,9 Stunden die Woche arbeiten, 10,5 Stunden mehr als die, die sich in der unteren Hälfte der Vermögensverteilung tummeln. Der Schluss liegt nahe: Die Millionäre können sich was leisten, weil sie was leisten. Aber wer würde schon unumwunden dem Umkehrschluss zustimmen? Jene, die sich nichts leisten können, leisten nichts? Die Alltagserfahrung bricht sich an der Lesart, dass es die eigene Arbeit sei, die Eigentum begründet.
Dennoch hält sich der Glaube hartnäckig. In der Wohnungsnot bestehen die Vermieter:innen von Immobilien darauf, ihr hart erarbeitetes Eigentum zu Geld machen zu dürfen, zur eigenen Altersvorsorge oder zur Steigerung des angelegten Kapitals. In der Pandemie werden die Profite der Impfstoffhersteller verteidigt: Ohne ihren Einsatz keine Rettung. Ökonomisch klingt das so: Ohne Kapitalinvestition – Kapital, das wohlgemerkt erarbeitet wurde und nun wagemutig riskiert wird – kein Anreiz, keine Effizienz, keine Produktion, kein Wachstum – kein Reichtum.
So existiert die verbreitete Verteidigung des Reichtums durch Arbeit parallel zu einem diffusen Verdacht, dass daran irgendwas nicht stimmt. Die Kritik an der »obszönen« Konzentration der Vermögen wird lauter. Empört kommentiert werden in der Pandemie Zahlen von Unternehmen, die in der Krise ihr Vermögen noch steigern konnten. Im Visier stehen auch jene, die ihren Nachkommen riesige Vermögen vererben. Die Kritik am leistungslosen Einkommen ist der Zwilling der Überzeugung, dass Arbeit Eigentum schafft. Beide liegen falsch.
Schon die Annahme, das herrschende Eigentumsrecht garantiere die Früchte der eigenen Arbeit, gerät beim Blick in den Arbeitsalltag ins Wanken. Träfe sie zu, so dürfte eine Tischlerin die von ihr produzierten Schränke, die sie in Lohn und Brot für ein Unternehmen am Tag gebaut hat, am Abend mit nach Hause nehmen. Sagen wir, sie hat zehn Schränke gebaut, dann könnte sie abzüglich der Produktionskosten für Holz, Leim, Werkzeugverschleiß, sagen wir, acht Schränke mitnehmen. Aber was will sie mit acht Schränken zu Hause?
Deshalb, so wird gemutmaßt, gibt es Geld. Tausch erleichtere die Verteilung der Güter in einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft: Die Tischlerin erhält einen Lohn und kann sich damit auf dem Markt versorgen. Wie praktisch. Aber erhält sie über diesen Umweg nicht die Früchte ihrer Arbeit? Das ist mitnichten der Fall. Der Lohn, mag er niedrig oder hoch sein, verkörpert nicht, was sie produziert hat, sondern das, was ihre Arbeitskraft funktionsfähig hält: Essen, Trinken, Miete, Fahrrad, Kleidung, Friseurbesuch und wenn es gut läuft, ein Jahresurlaub. Wie ein Akku, der immer wieder neu aufgeladen werden muss, reproduziert sie auf diese Weise ihre Arbeitskraft – eine Kraft, die als Einzige in der Lage ist, etwas hervorzubringen, was es zuvor noch nicht gab, wie beispielsweise einen Schrank. Dieser Schrank verkörpert einen neuen Gebrauchswert, dessen Wert das übersteigt, was die Tischlerin erhält, um ihren Akku aufzuladen. Das Produktionsergebnis allerdings geht in das Eigentum des Unternehmens über, so dass man mit Fug und Recht sagen kann, er eignet sich alle Schränke an, davon, sagen wir, zwei ohne Bezahlung.
Davon, dass die in Lohn und Brot stehenden Menschen die Früchte ihrer Arbeit ernten, kann also schwerlich die Rede sein. Ein Anreiz, zu arbeiten kann daher nicht von dort rühren. Es handelt sich vielmehr um Zwang. Da sie selbst keine Mittel haben, mit denen sie andere für sich arbeiten lassen könnten oder von denen sie ohne Arbeit leben könnten, müssen sie ihre Arbeitskraft an jene verkaufen, die diese Mittel haben. Das sind die Unternehmenseigner.
Worauf nun gründet nun ihr Eigentum? Darauf, dass sie im Betrieb mitarbeiten? Dies ist erstens mit wachsender Größe von Unternehmen immer unüblicher – welcher Aktionär von Tesla arbeitet schon in der Elektroautomontage? Zweitens: Selbst wenn der Eigentümer mitarbeitet, so ist seine Tätigkeit eine ganz andere als die seiner Beschäftigten. Um zu unserem Beispiel zurückzukehren: Als Manager oder Geschäftsführer organisiert er die Arbeit der Tischlerin, also Produktion und Verkauf der zehn Schränke auf dem Markt, mit einem bestimmten Motiv: Der für Arbeitskraft, Produktions- und Betriebskosten verausgabte Wert muss vermehrt zurückfließen. Aber wo kommt der vermehrte Wert her? Jedenfalls nicht von einem rein rechnerischen Aufschlag einer Gewinnmarge, wie beim Monopoly.
Das Geheimnis dieser Plusmacherei liegt vielmehr in der Arbeitskraft der Tischlerin. Die Marge repräsentiert vereinfacht gesagt den Wert der zwei oben erwähnten unbezahlten Schränke. Sie schlagen sich am Ende als Gewinn in der Bilanz des Unternehmens nieder. Und dieser Gewinn – nicht ein »Unternehmerlohn für geleistete Arbeit« – vermehrt den Reichtum des Eigentümers. Aus diesem Gewinn werden Zinsen für Kredite ebenso gezahlt wie die Miete für Immobilien und Grundeigentum. Es ist also die Arbeit der Lohnabhängigen, die das Einkommen der Eigentümer schafft, sei es Profit, Zins oder Grundrente.
Die Eigentümer eignen sich die Früchte der Arbeit anderer an. Das dürfen und tun sie ganz unabhängig davon, ob sie im Betrieb mitarbeiten oder nicht. Ihr Anrecht auf Einkommen resultiert nicht aus ihrer Arbeit, sondern allein aus ihrem Eigentum an Fabriken, Finanzkapital oder Immobilien. Das führt auch die Figur des Aktionärs vor, dem als »Coupon-Schneider« häufig »leistungsloses Einkommen« vorgeworfen wird. Sein Teil-Eigentum am Unternehmen beinhaltet keine Verfügung über eine bestimmte Maschine oder eine Fabrik, die er verkaufen könnte. Es beinhaltet allein ein Anrecht auf einen Teil des Gewinns – die Dividende – und das Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Arbeiten muss er dafür nicht. Ähnlich beim Kreditgeber: Ihm gehört eine Geldsumme, er leiht sie dem Betrieb auf Zeit und erhält dafür einen Zins, ohne tätig zu werden. Ähnlich beim Vermieter, dessen Anrecht auf Mietzins nur auf seiner Verfügung über die Immobilie beruht. Möglich sind derartige »leistungslose« Einkommen, weil im Kapitalismus Eigentum selbst eine Einkommensquelle ist.
Die Tätigkeit der Lohnarbeitenden schafft also den Reichtum, und zwar doppelt: Zum einen produziert sie die Einkommen der Reichen, die sich zu großen Vermögen addieren. Zum anderen hängt der Marktwert dieser Vermögen von nichts anderem ab als von ihren in die Zukunft hochgerechneten Erträgen: Eine Fabrik, von der zwei Millionen Gewinn erwartet werden, ist doppelt so viel wert wie eine, von der nur eine Million erwartet wird. Ein Haus, in das niemand ziehen will, ist kapitalistisch gesehen nichts wert. Teuer dagegen ist ein Haus im Zentrum einer boomenden Stadt, das viel Mieteinnahmen verspricht. Der Reichtum der Reichen bemisst sich danach, was er an künftigen Einnahmen verspricht. Und diese Einnahmen muss letztlich die Lohnarbeit schaffen.
Fazit: Die einen gründen ihr Eigentum auf fremde Arbeit, die anderen, die arbeiten, müssen ihr Einkommen im Wesentlichen für das tägliche Leben ausgeben. Beide leben unter Zwang: Die Ersteren müssen den Profit maximieren, die Letzteren müssen dafür lohnarbeiten. Auf diese Weise dienen beide dem herrschenden Produktionszweck, der Vermehrung von Kapital in den Händen der Eigentümer. Die Antwort auf das Problem einer ungerecht erscheinenden Eigentumskonzentration ist daher nicht im Eigentum allein zu suchen, sondern in der Art und Weise, wie gesellschaftliche Produktion organisiert ist.