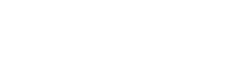Wer schon vor Corona wenig verdiente, der verliert jetzt auch am meisten. Das Virus trägt keine Schuld: Es liegt an systemischer Ungleichheit
Artikel erschienen im Freitag, 26. November 2020, Ausgabe 48/2020, S. 6
Menschen, denen es vor Ausbruch der Corona-Pandemie schon schlecht ging, geht es jetzt noch schlechter. So ungefähr lautete das Fazit des Verteilungsberichts 2020, den das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) vergangene Woche der Öffentlichkeit vorstellte. „Die Einkommensungleichheit wird durch die Corona-Krise noch weiter verstärkt“, titelten die Wissenschaftler*innen. „Noch weiter verstärkt“ bedeutet, dass die Ungleichheit bei den Einkommen bereits seit 2010 gestiegen war. Besonders jene, die am allerwenigsten verdienen, hätten vom Aufschwung der vergangenen Jahre kaum profitiert, die ärmsten zehn Prozent haben sogar verloren: „Die Einkommen des untersten Dezils blieben 2017 noch unter denen von 2010“, heißt es im Bericht.
Die sogenannte Corona-Krise hat die Spaltung noch einmal verstärkt: In der Pandemie verlieren die „Unterprivilegierten“ – Geringverdiener*innen, prekär Beschäftigte, Leiharbeiter*innen, Minijober*innen etc. – häufiger und vergleichsweise mehr an Einkommen als Besserverdienende beziehungsweise Festangestellte oder Beamte. Einer der Hauptgründe ist die Kurzarbeit. Von ihr betroffen sind meist Branchen und Sektoren, in denen ohnehin wenig gezahlt wird. Auch Eltern mit Kindern oder Migrant*innen erlitten ungleich höhere Einkommenseinbußen als Kinderlose oder Menschen ohne Migrationshintergrund. Das aber ist dem WSI zufolge weniger ein Problem bestimmter Branchen, sondern liegt an Engpässen bei der Kinderbetreuung und an Diskriminierung. Kurz: In der Konkurrenzgesellschaft haben potenziell benachteiligte Menschen auch in der Krise relativ stärker zu leiden.
Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband, der kurze Zeit nach der Veröffentlichung des WSI seinen Armutsbericht 2020 vorlegte, gab bekannt, dass die Armutsquote in Deutschland einen historischen Wert erreicht habe. Man habe es mit der größten gemessenen Armut seit der Wiedervereinigung zu tun, wobei die Auswirkungen der Corona-Krise diesen Trend noch einmal spürbar beschleunigen dürften. Dabei habe das soziale Sicherungssystem bereits vor Corona nicht vor Armut schützen können.
Den Befund des WSI präsentierten die Medien als ein Problem des Virus Sars-Cov-2: „Corona macht Arme noch ärmer“, „Corona spaltet Arm und Reich“, „Corona belastet vor allem niedrige Einkommen“, lauteten die Schlagzeilen. Es ist allerdings weniger das Virus, das arm macht, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen es sich verbreitet. Das sieht auch das WSI so, wenn es heißt, diese Krise offenbare wie keine andere zuvor „soziale Missstände in unserer Gesellschaft“.
Was verletzlich macht
Zu diesen Missständen gehört die Existenz atypischer und prekärer Beschäftigungsverhältnisse und ein breiter Niedriglohnsektor. Das ist es, was viele Menschen in der Corona-Krise verletzlich macht und vermutlich ein Grund dafür, dass die Menschen europaweit wütend gegen die Maßnahmen zum Infektionsschutz auf die Straße gehen. So sehen die WSI-Forscher*innen in den zunehmenden sozialen Verwerfungen auch eine Gefahr für die Demokratie: Die von ihnen befragten Erwerbspersonen, die in der Pandemie Einkommen verloren, bewerteten die politische und soziale Situation in Deutschland insgesamt deutlich kritischer: „… sie zeigen sich im Durchschnitt empfänglicher für Verschwörungsmythen zur Pandemie.“
Wenn im medialen Diskurs mit Sprachbildern häufig dem Virus die Schuld für die sozial desaströse Lage gegeben wird, andere wiederum die Gefahr des Virus verharmlosen oder gar leugnen und ihr Unglück einer obskuren höheren Macht in die Schuhe schieben, geraten die eigentlichen Ursachen aus dem Blick: die dahinter liegenden politökonomischen Zusammenhänge, besonders ihre Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Unter dem Schlagwort Agenda 2010 orchestrierte Anfang der 2000er die Sozialdemokratie gemeinsam mit den Grünen einen Reformprozess, dessen bekanntester Teil die Hartz-Gesetze wurden. „Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt“, verkündete Kanzler Gerhard Schröder stolz in einer Rede vor dem World Economic Forum in Davos 2005.
Jener Mann, der heute Homestorys über Juckpulver in Hagebutten auf Instagram postet, trat damals an, um die sozialen Sicherungssysteme „neu zu justieren“. Hintergrund waren eine seinerzeit gewachsene Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und die sich verschärfende Weltmarktkonkurrenz, unter deren Druck die EU die Losung ausgab, zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Mittel dazu waren unter anderem die Absenkung der Lohnnebenkosten, die Entlastung des Kapitals von Steuern, der Umbau der Sozialsysteme, die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und die Privatisierung der Rente. Dem Armutsforscher Christoph Butterwegge zufolge hätten die damaligen Planer ihr „Hauptaugenmerk auf das Kapital und seine Möglichkeiten der Profitmaximierung“ gerichtet, „weil sie dessen Interessen mit dem Allgemeinwohl gleichsetzten“. (Lesen Sie nebenan einen Text von Christoph Butterwegge.) Ein Fehlschluss, der bis heute nahezu parteiübergreifend handlungsleitend ist für sozial- oder wirtschaftspolitische Reformüberlegungen.
Die Ursachen für die sozialen Verwerfungen in einem der ökonomisch stärksten Länder der Welt reichen noch tiefer. Dies zeigt sich, wenn man die Vermögensverteilung in den Blick nimmt. Sie ist in Deutschland höchst ungleich. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 35 Prozent des Gesamtvermögens der Gesellschaft, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die untere Hälfte der erwachsenen Bevölkerung hält einen Anteil am Gesamtvermögen von lediglich 1,3 Prozent. Wobei das Vermögen in Deutschland größtenteils aus Betriebsvermögen (40 Prozent) sowie aus nicht selbst genutzten Immobilien (25 Prozent) besteht.
Wie viel Geld man jeden Monat verdient und wie viel Geld man in Immobilien, Aktien, Staatsanleihen oder Bankguthaben angelegt hat, macht einen Unterschied ums Ganze. Sowohl Investitionen in Immobilien als auch in Unternehmen haben den Zweck, mittels der Arbeit anderer einen Gewinn zu erzielen. Im ersten Fall ist es die Miete und damit das Einkommen, im zweiten Fall ist es die Arbeit unmittelbar, die sich an Renditeerwartungen messen lassen muss. Einkommen und Vermögen sind daher abstrakt gesprochen Ausdruck unterschiedlicher Funktionen von Eigentum. Mit dem Geld, das Einkommen bringt, kann man über einen begrenzten Umfang dessen verfügen, was die Gesellschaft arbeitsteilig produziert hat: Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, Möglichkeiten der Fortbewegung, Reisen, Friseurbesuche und dergleichen mehr. Dieser Konsum dient ökonomisch betrachtet dazu, die Arbeitskraft der Einkommensbezieher zu erhalten, was meist dazu führt, dass am Ende des Monats kein oder kaum Geld übrig ist.
Vermögende hingegen haben mehr Geld, als sie zum Konsum brauchen – sie können es zwecks Vermehrung investieren. Ab einer gewissen Größe verleiht ihnen ihr Vermögen die Macht, über die Arbeitskraft anderer zu verfügen. Die Eigentümer von Betriebsmitteln, Maschinen, Immobilien und Naturressourcen können die große Mehrheit derer, die solches Eigentum nicht haben, für sich arbeiten lassen. Sie tun das mit dem Zweck, das eingesetzte Kapital weiter zu mehren. Einmal um einen erneuten Produktionsprozess in Gang zu setzen (Reinvestitionen), einmal um es zu konsumieren, zu sparen oder zu vererben.
So ist es erstens kein Wunder, dass die reichsten Haushalte jene sind, die über Betriebsvermögen verfügen. Und es ist zweitens kein Wunder, dass Milliardäre in Deutschland in der Pandemie noch reicher werden, als sie es vorher schon waren. Zu den Profiteuren gehören Unternehmen aus Branchen, die als systemrelevant gelten (Lebensmittel, Gesundheit) oder die in der Krise einen nicht gekannten Aufschwung erleben (Logistik, Online-Handel, digitale Technologien). Auch der Immobiliensektor gewinnt. Hauptgrund dafür sei der anhaltende Immobilienboom, zitiert die Süddeutsche Zeitung eine Studie, die mit dem in diesen Zeiten wohl unvermeidlichen Sprachwitz schlussfolgerte, dass die Preise von Immobilien „gegen die Pandemie immun“ seien.
Alles nur Abmilderung
Der Fleischproduzent Tönnies und der Online-Händler Amazon sind Paradebeispiele dafür, wie prekäre und schlecht bezahlte Beschäftigte, miserabel geschützt vor der Virusinfektion, den Reichtum der Betriebsvermögenden in der Krise noch vermehren. Es scheint, als würde das berühmte Zitat von Bertolt Brecht in der durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise sichtbarer denn je: „Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an. Da sagt der Arme bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“
Das WSI empfiehlt nun mehrere politische Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Lücke zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft: die Anhebung des Kurzarbeitergeldes, die Gewährleistung einer institutionellen Kinderbetreuung, Weiterbildung, Erhöhung von Hartz IV, die Verlängerung des Arbeitslosengeldes I, eine Anhebung des Mindestlohns, die Stärkung der Tarifbindung, höhere Steuern auf Kapitalerträge, eine Reform der Erbschaftssteuer, Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen von Migrant*innen und Beratung für Bedürftige. Man wolle damit dort ansetzen, wo Ungleichheit entstehe, so das Institut.
So wichtig diese Forderungen sind, sie setzen nicht da an, wo Ungleichheit entsteht. Sondern sie stärken – was nicht gering zu schätzen ist – im besten Fall die Einkommensseite gegenüber der Vermögensseite, mildern die bestehende Asymmetrie und könnten so die Lage vieler Menschen in der Pandemie verbessern. An der grundsätzlichen Existenz der beiden Funktionen von Eigentum, mit anderen Worten: an dem Herrschaftsverhältnis zwischen den Besitzenden und den Nicht-Besitzenden, ändert dies nichts und damit nichts an der Ungleichheit der Markteinkommen.
Wir haben es mit einer systemischen und nicht zufälligen oder vorübergehenden Ungleichheit zu tun. Sozialpolitische Reformen zu ihrer Abmilderung sind dabei den selbst gemachten Sachzwängen kapitalistischer Weltmarktkonkurrenz unterworfen. Dieser Wettbewerb wird nun aber gerade über die Höhe von Lohnkosten, Einkommen, Besteuerung von Kapitalerträgen, Flexibilität der jeweiligen Arbeitsmärkte, also über die Standortkonkurrenz ausgefochten, von Auflagen für den Umweltschutz ganz zu schweigen.
Solange diese Zusammenhänge nicht in den öffentlichen Diskurs gebracht werden, bleiben sie undurchsichtig. Man darf sich nicht wundern, wenn die psychosozialen Folgen für die in der Konkurrenz Vereinzelten dann dazu führen, dass obskure Verschwörungsmythen die Ursachen personalisieren und die Solidarität mit den Erkrankten, den Gefährdeten sowie den Helfenden verschwindet.