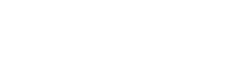Der Soziologe Vivek Chibber über Hochschulmarxismus, Anti-Diskriminierung und Arbeiterbewegung. Das Gespräch führten Stephan Kaufmann und Sabine Nuss
Herr Chibber, Sie stehen politisch weit links und machen kein Geheimnis daraus, ein Marxist zu sein. Wie haben Sie es geschafft, in den USA eine Professur an einer renommierten Universität zu bekommen?
Ja, das ist ungewöhnlich. Aber auch erklärbar: Erstens verzichte ich in meinen Texten auf marxistischen Jargon, ich arbeite sehr empirisch. Zweitens ist der Bildungsmarkt der USA im Vergleich zum deutschen System riesig. Daher ist er schwieriger zu kontrollieren, und fast jeder bekommt einen Job, auch wenn man weit links steht. Und schließlich sind die USA ein sehr liberales Land. Man legt dort Wert auf unterschiedliche Meinungen und leistet sich einen gewissen Pluralismus. Meiner Erfahrung nach ist es ausgerechnet in Ländern mit starken sozialdemokratischen Parteien noch schwerer, Marxist zu sein und davon zu leben.
Die USA, ein Paradies für linke Wissenschaftler?
Nicht ganz. Es gibt natürlich Vorurteile gegen Marxisten, und man zahlt einen hohen Preis dafür, einer zu sein: Du kommst nie in die Top-Positionen, du erhältst keine Zuschüsse oder Spenden und musst mit weniger Geld auskommen. Das ist nichts für bürgerliche Akademiker, die Karriere machen wollen.
Im Interview
Vivek Chibber, Jahrgang 1965, ist Professor für Soziologie an der New York University und Herausgeber der marxistischen Theoriezeitschrift Catalyst. Stephan Kaufmann und Sabine Nuss sprachen mit ihm darüber, wie er als Marxist eine Professur in den USA bekommen hat, über alternative Wirtschaftssysteme und die Notwendigkeit einer neuen Arbeiterbewegung. Von Chibber erschien kürzlich »Das ABC des Kapitalismus« in deutscher Übersetzung. Band I: Kapitalismus verstehen, Band II: Kapitalismus und Staat, Band III: Kapitalismus und Klassenkampf. Erhältlich bei dem Online-Magazin Jacobin für jeweils 5 €, im Set 10 €.
Ihre drei kleinen Bändchen »Das ABC des Kapitalismus« sind gerade in Deutschland erschienen. Im Vorwort steht der Satz »Der Kapitalismus ist kompliziert, aber nicht schwer zu verstehen«. Stimmt das?
Ja. Jeder Aspekt der sozialen Realität im Kapitalismus hat mehrere Dimensionen. Dadurch erscheint er kompliziert. Doch die Essenz des Kapitalismus zu verstehen, ist sehr einfach: Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die fast alles besitzen, und eine große Mehrheit, die fast nichts besitzt. Diese große Mehrheit muss jeden Tag für diese besitzende Klasse arbeiten gehen. Von diesem Punkt aus kann man alles erzählen, man muss nur den Spuren folgen.
Es gibt schon so viele Einführungen in den Kapitalismus. Wozu noch eine?
Die meisten Werke, die ich gefunden habe, handeln weniger vom Kapitalismus, sondern eher von Karl Marx und seiner Theorie, die schlicht nacherzählt wird. Da wird dann mit der Arbeitswerttheorie gestartet, also dass die Arbeit den Wert bestimmt. Dann wird über Warenfetischismus geredet. Es wird die Logik des ersten Bands des »Kapital« nachvollzogen. Das Problem: Wer nie oder schon lange nicht mehr an einer Universität war, kann das kaum verstehen. Bei der Erklärung der Wertformanalyse fangen die Leute an, Löcher in die Luft zu starren. Es ist pädagogisch falsch, Marx’ Darstellungsweise des Kapitals einfach zu folgen. Man muss mit dem beginnen, was die Leute kennen und sehen können – und dann direkt an die Substanz: Was ist Kapitalismus und wie funktioniert er?
Wer soll das lesen – welches Publikum erhoffen Sie sich?
In meinen Einführungen vertrete ich eine recht orthodoxe marxistische Sicht, allerdings ohne marxistischen Jargon. Das richtet sich an Leute, die nie etwas mit Marx zu tun hatten und die sich eigentlich auch gar nicht dafür interessieren. Die besten Publikationen zum Kapitalismus stammen tatsächlich aus den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, als linke Autoren noch in Parteien oder Bewegungen eingebunden waren. Ab den sechziger Jahren dann gingen sie an die Universitäten und bauten ihre Karrieren darauf auf, unverständliches Zeug zu schreiben.
Sie fordern Einfachheit. Dann erklären Sie uns in kurzen einfachen Worten: Warum soll man den Kapitalismus überwinden?
Damit man unter Bedingungen leben kann, in denen die Menschen aufblühen, das heißt, über ihr Leben autonom bestimmen können. Das ist im Grunde eine liberale Konzeption. Im Kapitalismus aber ist sie nicht zu verwirklichen. Denn die meisten Menschen verbringen den größten Teil ihres Tages unter der Aufsicht und Kontrolle eines anderen Menschen – nämlich an ihrem Arbeitsplatz. Sie verkaufen jeden Tag für eine bestimmte Anzahl an Stunden nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch ihre Autonomie. Damit verlieren sie Freiheit, was wiederum ein Verlust an Selbstbestimmung bedeutet. Die Macht, die die Kapitalisten über die Arbeiter ausüben, dient nicht dem Wohl des Arbeiters, sondern dem des Unternehmens, was sich oft genug gegen den Arbeiter wendet. Wenn man nun den Rest seines Lebens für sein Überleben von jemandem abhängt, ist man gezwungen, ständig dafür zu sorgen, dass man wettbewerbsfähig bleibt, das heißt billiger und produktiver zu sein als die anderen. Das ganze soziale Umfeld ist von dieser Konkurrenz beeinflusst und geformt, das reicht bis in die Freizeit hinein.
Autonomie, das klingt gut. Doch wenn man gegen Kapitalismus argumentiert, wird einem meist entgegengehalten: »Er ist das einzige Wirtschaftssystem, das funktioniert. Schau Dir die Sowjetunion an!« In Berlin werden derzeit Forderungen nach Vergesellschaftung von Wohnraum mit dem Schlagwort »DDR!« gekontert.
Der Verweis auf den Ostblock ist ein ernsthafter Einwand, und Linke sollten sich damit auseinandersetzen. Die Linken haben lange den Fehler gemacht, Sozialismus mit zentraler Planung als einzige Form von Sozialismus gleichzusetzen. Es gibt aber bislang keinen Beleg, dass eine ausschließlich zentral geplante Ökonomie funktioniert.
Was wäre die Alternative?
Man muss dem privaten Kapital und dem Markt möglichst viele Produktionsbereiche abtrotzen, und dann schauen, was darüber hinaus möglich ist. Es ginge zunächst also darum, große Teile der Wirtschaft der Profitlogik zu entziehen und so an Freiheit zu gewinnen.
Warum nicht gleich alle Bereiche der Profitlogik entziehen?
Ich glaube nicht, dass eine komplexe gesellschaftliche Produktion ohne Marktelemente funktionieren kann.
Von einer Wirtschaft jenseits des Kapitalismus sind wir weit entfernt. Die Wohlhabenden heute steuern nicht nur die Produktion. Sie besetzen auch die Spitzen der Politik, zumindest in den USA, wo fast alle Politiker Millionäre sind. Ginge es den Armen besser, wenn sie von Menschen der Mittelklasse regiert würden?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Denn Reiche machen tendenziell Politik für die Reichen, von denen sie abhängen: In den USA bezahlen die Reichen die Wahlkampfkampagnen. Wenn ein Politiker sich um ein Amt bewerben will, muss er also erst mal Millionen einwerben. Man nennt das die versteckte Wahl. Doch letztlich wäre der Unterschied für die Bevölkerung gering. Denn selbst wenn ein Politiker arm wäre und sich für die Armen einsetzen wollte – ist er erst einmal im Amt, dann ist er gegenüber dem Kapital rechenschaftspflichtig und damit den Armen gegenüber feindlich gesinnt.
Worin besteht die Rechenschaftspflicht? Politiker müssen ja nicht monatlich in den Konzernzentralen Bericht erstatten.
Nehmen wir als Beispiel Deutschland: Hier sind Politiker weniger auf Zuwendungen der Reichen angewiesen als in den USA. Aber auch hier ist die Politik vom Kapital abhängig. Um sein politisches Programm finanzieren zu können, braucht ein regierender Politiker Geld. Das kriegt er durch Steuern. Die Steuereinnahmen sind abhängig vom Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung. Die wiederum sind abhängig von den privaten Investitionen – und damit von den Unternehmen. Das erste, was ein gewählter Politiker daher tun muss, ist, für ein gutes Investitionsklima zu sorgen. Das macht Kapitalisten glücklich und reicher. Selbst eine kommunistische Partei an der Regierung wäre für die Verwirklichung ihrer besten Ansichten abhängig von privaten Investitionen. Das ist eine strukturelle Barriere für jede Form von linken Reformen. Das haben sozialdemokratische Regierungen in der Vergangenheit erfahren müssen.
Wenn einer Regierung die Hände weitgehend gebunden sind, müssen soziale Fortschritte von unten kommen: Sie sagen, es braucht eine starke Arbeiterbewegung für den Kampf sowohl gegen das Kapital wie auch für eine Verbesserung der Lebensbedingungen. Die großen Mobilisierungen derzeit kommen allerdings aus anderen Richtungen: gegen den Klimawandel wie Fridays for Future, gegen Rassismus oder für bürgerliche Freiheiten. Warum ist das so?
Es scheint, als sei die Klassenfrage ausgeschöpft, dort wird kein Raum mehr für erfolgreiche Forderungen gesehen. Nicht weil die Klassenfrage gelöst wäre – ich würde das mangelnde Interesse an ihr nicht als Beleg dafür sehen, dass die Arbeiter glücklich sind mit ihrer Situation. Aber das Machtungleichgewicht auf diesem Feld ist so enorm, dass die Leute glauben, sie könnten nichts tun. Die anderen Themen scheinen für Veränderung offener zu sein – im Kampf gegen Klimawandel und Rassismus hat man schließlich auch große Teile der Eliten auf seiner Seite. Zudem sind auf diesen Mobilisierungsfeldern auch die sozialen Kosten niedriger.
Wie meinen Sie das?
Wenn sich Menschen gegen ihre Arbeitgeber auflehnen, riskieren sie Job und Lebensunterhalt. Ganz anders ist es, wenn sie gegen den Klimawandel protestieren: Man geht nachmittags für eine Stunde auf eine Klimademo, dann wieder nach Hause vor den Fernseher und am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Da ist kein Risiko, jeder kann es tun. Es sollte uns nicht sehr überraschen, dass viele Leute genau hier ihre Energie reinstecken – wobei ich die Anliegen damit nicht schlechtreden möchte, sie sind enorm wichtig.
Wir sehen derzeit weltweit große Mobilisierungen – gegen Preiserhöhungen, gegen Klimawandel, gegen Korruption und Rassismus. Braucht es denn unbedingt eine Arbeiterbewegung?
Ja. Die Arbeiterklasse hat seit den siebziger Jahren in unterschiedlichen Geschwindigkeiten eine Stagnation oder Verschlechterung ihres Lebensstandards erleben müssen. Das berührt alles: soziale Beziehungen, die Nachbarschaft, den Zugang zur Gesundheitsversorgung, alle scheinbar nicht-klassenspezifischen Dimensionen des Lebens. Ohne eine Arbeiterbewegung wird sich all das erstens nicht verbessern. Und ohne Klassenkampf werden wir zweitens auch all die anderen Probleme nicht lösen. Beispiel Rassismus: Das Problem der schwarzen Bevölkerung in den USA ist wesentlich ein ökonomisches. Mit Anti-Diskriminierungsgesetzen hilft man nur dem obersten Drittel der schwarzen Bevölkerung, also jenen, die um die besseren Jobs konkurrieren. Der Kampf um Gleichstellung ist daher ein Kampf der schwarzen Oberschicht um bessere Bedingungen.
Erklären Sie das bitte!
Es gibt zwei Wege, wie People of Colour diskriminiert werden. Entweder sie kriegen weniger Geld für die gleiche Arbeit. Oder sie kriegen den Job erst gar nicht, auch wenn sie qualifiziert wären. Diese Art der Diskriminierung erklärt allerdings nur zehn Prozent aller Lohnunterschiede zwischen People of Colour und der weißen Bevölkerung in den USA. Das Hauptproblem vor allem der schwarzen Menschen ist, dass sie die miesen Jobs haben, weil sie aus armen Familien kommen, weil sie in schlechten Gegenden wohnen, weil sie im Gefängnis saßen, weil sie schlechte Schulen besuchen – ihre Armut vererbt sich über Generationen. Um das zu ändern, hilft keine (rechtliche) Gleichstellung, man muss die Prioritäten der staatlichen Ausgabenpolitik ändert. Wer kontrolliert das? Das Kapital. Da kann nur eine Massenmobilisierung Druck ausüben. Und welche Klasse könnte das tun? Das sind nicht die weißen oder schwarzen Reichen. Sondern die Arbeiter, die schwarzen und die weißen. Antirassistischer Kampf geht nur mit Klassenkampf, sonst ist er verloren.
Wo ist die Arbeiterbewegung hin?
Sie ist nirgends. Sie ist tot. Wir sehen allerdings die ersten Anfänge einer Wiederbelebung der Arbeiterbewegung. Einer, die heutzutage entweder nicht organisiert ist oder von Organisationen kontrolliert wird, die nicht immer die besten Interessen im Sinne hat. Die Organisierung ist eine riesige Aufgabe. Möglicherweise ist es allerdings zu spät. Möglicherweise ist der Klimawandel schneller als wir.
Eine Möglichkeit der Organisierung der Beschäftigten ist über Gewerkschaften. Allerdings schrumpft ihr Einfluss. In den USA ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad auf nur noch acht Prozent der Beschäftigten gefallen. Ist das allein die Schuld der Gewerkschaften?
Nicht allein. Aber die Gewerkschaften sind gegen ihre eigene Entmachtung nicht entschieden genug vorgegangen. Sie haben ihre Schwächung zur Kenntnis genommen und sich gesagt: Dann versuchen wir es jetzt eben mit weniger Macht. Aber diese Macht muss man sich erkämpfen – es kommt nicht jede Woche eine Lieferung Einfluss vorbei, und wenn man leer ausgeht, wartet man einfach bis zur nächsten Woche. Das Kapital lässt nicht locker. Es wird immer versuchen, deine Position zu unterminieren. Wenn man sich zurücklehnt und sagt, dann kämpfen wir eben mit dem, was wir haben, wird das nichts. Das was wir haben, reicht schon seit zehn Jahren nicht mehr.
Dieses Jahr ist auch ihr Buch »Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals« auf Deutsch erschienen. Es ist umstritten. Sie gehen darin ins Gericht mit einer Sichtweise, die sagt, dass wir im Westen die Gesellschaften außerhalb Europas ausschließlich durch »unsere Brille« betrachten. Ist da nicht was dran?
Ich sage nicht, dass der Eurozentrismus nicht existieren würde. Noch behaupte ich, dass es Rassismus, wie die postkoloniale Theorie ihn thematisiert, nicht geben würde. Was ich aber kritisiere, ist die Unterstellung, dass eine Theorie, nur weil sie aus dem Westen ist, nicht in der Lage wäre, den Osten zu verstehen. Kapital, Lohnarbeit, Klasse, das sind universelle Kategorien, bei aller kultureller Differenz. Dem Kapitalismus in Indien ist es egal, wie eine indische Hochzeitszeremonie abläuft. Und mit den Gesetzen des Kapitalismus ist es wie mit denen der Physik: Sie sind auch in Indien die gleichen wie in Europa.
Vivek Chibber (54) ist Professor für Soziologie an der New York University und ein höchst umstrittener Wissenschaftler. Besonders unter Wissenschaftlern der Postcolonial Studies hat er sich viele Feinde gemacht. In seinem Buch „Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals“ (Englische Originalausgabe: Verso 2013) übte er eine Generalkritik an führenden Vertretern der Fachrichtung und ihren Thesen. Zwar ist es den Postcolonial Studies laut Chibber zu verdanken, dass mit der Vorstellung gebrochen wurde, der Kolonialismus habe den unterdrückten Völkern in Afrika, Asien und Lateinamerika Zivilisation, Fortschritt und Demokratie gebracht und damit eine „zivilisatorische Mission“ erfüllt – eine Mission, mit der die Eroberung und Ausbeutung von Weltregionen legitimiert wurde. Ebenso ermöglichte der Aufstieg der postkolonialen Theorie, dass Autorinnen und Autoren aus den einstigen kolonialisierten Regionen Gehör fanden und Teil des akademischen Kanons wurden.
Allerdings sei die postkoloniale Theorie nicht nur empirisch fehlerhaft, so Chibber. Sie habe genau den „Orientalismus“ wiederbelebt, den sie angeblich kritisieren wollte: Aus ihrer Sicht seien Gesellschaften des globalen Südens kulturell völlig anders als der Westen und müssten entsprechend anders begriffen werden. Kategorien, mit denen hierzulande Kapitalismus analysiert werde – Lohnarbeit, Klasse, Kapital – seien laut Postcolonial Studies ein westliches Konzept und nicht universell anwendbar. Chibber anerkennt zwar die kulturellen Unterschiede zwischen den Regionen der Welt, besteht aber auf der universellen Gültigkeit der Kategorien des Kapitalismus: „Auch in Indien liegt die Macht bei großen Konzernen, auch in Indien sind die meisten Menschen Lohnarbeiter, die für andere arbeiten müssen.“
Das Buch löste eine heftige Debatte im angelsächsischen Raum aus. Man warf Chibber vor, die Breite der postkolonialen Theorie nicht angemessen im Blick gehabt zu haben. Außerdem existiere bei ihm keine analytisch schlüssige Vorstellung davon, wie die beiden Ebenen – jene des Besonderen und jene des Universalen – zu vermitteln wären, so dass er mit seiner Kritik der postkolonialen Theorie das Kind gleich mit dem Bade ausschütte. Fünf Jahre nach Erscheinen der englischen Ausgabe bekräftigt Chibber im Vorwort der deutschen Übersetzung (Dietz Verlag Berlin 2018) seine Positionen und betont, dass die Überwindung des „kulturellen Essentialismus“ der postkolonialen Theorie im gegenwärtigen europäischen Kontext noch wichtiger geworden sei. Wirtschaftliche Stagnation und Migration hätten einen Aufschwung des rassistischen und ethnizistischen Chauvinismus ausgelöst und zu den Erfolgen rechtsextremer politischer Parteien beigetragen. Diese politischen Strömungen würden sich einer Sprache des rassistischen und kulturalistischen Essentialismus bedienen, der Unterschiede zwischen und die Überlegenheit von bestimmten »Rassen« behauptet und in »Fremden« eine Bedrohung sieht. Ein theoretischer Rahmen, der von unüberbrückbaren Unterschieden zwischen dem Osten und dem Westen ausgehe, spiele dem in die Hände. Nach wie vor gelte es, die Zentralität »zweier Universalismen« zu benennen: der „universelle Trieb des Kapitals, unser Leben zu beherrschen und uns auf seiner Jagd nach Profit gegeneinander auszuspielen, und auf der anderen Seite die gemeinsame Menschlichkeit, die uns über Kulturen, Sprachen und Religionen hinweg verbindet“. Nun hat der streitbare Kapitalismuskritiker sich an einem neuen Großprojekt versucht: In den drei schmalen Bänden „Das ABC des Kapitalismus“ erklärt er in einfacher Sprache das herrschende Wirtschaftssystem und warum man es überwinden sollte.