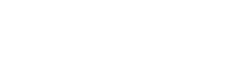Privateigentum wird gern zum Wohlstandsgaranten verklärt. In Wahrheit geht es um Verfügungsrecht, also Macht. Im Kapitalismus dreht sich alles darum.
Wenn die Sorge um den Besitz jeweils Einzelnen vorbehalten ist, wird dies nicht die jeweiligen Vorwürfe produzieren; die Sorge um den Besitz wird so eher gesteigert, weil nun jeder Einzelne sich seinem Eigentum widmet.« Dieser Satz ist etwa 2.400 Jahre alt. Er stammt von Aristoteles. Mitunter wird er als Kronzeuge für die Vorzüge des Privateigentums zitiert. Das hat Gewicht. Schon Aristoteles habe das so gesehen, der bekannteste und einflussreichste Philosoph der Geschichte. Na dann.
Der »Wirtschaftsweise« Lars Feld erklärte jüngst, in einem Interview über Enteignung und Verstaatlichung befragt, ganz aristotelisch: »Ökonomisch betrachtet ist Privateigentum extrem wichtig, weil es sicherstellt, dass jeder mit seinem Besitz schonend umgeht, ihn weiterentwickelt und vermehrt.« Im Kern ist hier die herrschende Legitimation des Privateigentums ausgesprochen, sie lautet: Nur Privateigentum kann Wirtschaftswachstum und Wohlstand garantieren. Bewiesen sei dies hinreichend, so sagen ihre zahlreichen Verfechter, fast immer unter Verweis auf die historische Erfahrung im real existierenden Sozialismus, der, man habe das ja gesehen, an Staats- oder Gemeineigentum gescheitert sei.
Intellektuelles Schmiermittel
Diese Anschauung gilt als unumstößlich, weil angeblich historisch bewiesen, wahr und allgemein gültig, sie ist zu einem der hartnäckigsten und am weitesten verbreiteten Mythen unserer Zeit geronnen, sie trifft im Alltagserleben auf eine gewisse Plausibilität, was ihre Stärke fördert, sie trifft kaum auf entkräftende Gegenargumente, sie hat eine ideologische Funktion und das, seit es kapitalistische Produktionsweise gibt, man könnte sagen, sie ist ihr intellektuelles Schmiermittel.
Etliche von Linken gern als neoliberal bezeichnete Maßnahmen, wie Privatisierungen, Deregulierungen und Liberalisierungen, besonders wirksam seit den 1970er Jahren, wurden so gerechtfertigt und wer bei den aktuellen Debatten um Enteignung genau hinhört, wird sie auch da wieder entdecken. Sogar die Rückverwandlung der Eigentumsverhältnisse in kapitalistische in den postsozialistischen Staaten gründete sich darauf. Privatisiert haben die ehemaligen Anhänger des Volkseigentums explizit mit dem Ziel, aus allen Arbeitern endlich Eigentümer zu machen. Man erhoffte sich davon mächtige »Motivationsstimuli« und dadurch dann – abermals – Wachstum und Wohlstand. Der erste Sekretär des Moskauer Stadtkomitees der KPdSU, Juri Anatoljewitsch Prokofjew, versprach: »Wenn alles privatisiert ist, dann werden alle ein bisschen mehr Wurst bekommen.«
Karl Marx schiebt man oft in die Schuhe, er wollte Privateigentum abschaffen, um Staatseigentum einzuführen. Mitnichten. Was er zum Aufstand der Pariser Kommune sagte, lässt anderes vermuten. Ja, schrieb Marx, die Kommune habe die Enteignung der Enteigner beabsichtigt, aber: »Sie wollte das individuelle Eigentum zu einer Wahrheit machen, indem sie die Produktionsmittel, den Erdboden und das Kapital, jetzt vor allem die Mittel zur Knechtung und Ausbeutung der Arbeit, in bloße Werkzeuge der freien und assoziierten Arbeit verwandelt.«
Individuelles Eigentum? Was kann das sein, im Gegensatz zu Privateigentum? Uwe Wesel, der große Historiker des Eigentumsrechts, hat einmal gesagt, es sei gar nicht so leicht zu untersuchen, wie Eigentum in der Frühgeschichte der Menschheit aussah, man könne nämlich darüber streiten, »ob überhaupt schon Recht ist, was uns da begegnet«. Eigentum ist Verfügungsrecht, ein Blick in die Frühformen des Rechts ist daher produktiv, »weil man dann besser erkennt, was das eigentlich ist, unser Recht«. Man muss nicht so weit zurückgehen, wie Wesel es getan hat. Schon der historische Ursprung des Kapitalismus, die Auflösung feudaler und die langsame Entstehung kapitalistischer Eigentumsverhältnisse, hilft zu verstehen, was das ist, unser Eigentum.
Geburtsstätte der kapitalistischen Produktionsweise
Es ist ein Gemeinplatz, dass England die Geburtsstätte der kapitalistischen Produktionsweise ist. Es gibt Streit darüber, ob das Zufall oder zwingende Folge von Bedingungen war, die nur dort in dieser Form ausgereift waren. Für die 2016 verstorbene marxistische Historikerin Ellen Meiksins Wood war es einer für jene Zeit einzigartigen politischen Konstellation zu verdanken, eine, die zu einer umfassenden Landvertreibung führte. Diese Vertreibung war brutal, gewalttätig, es war Enteignung im großen Stil, berühmt geworden unter dem Begriff »Enclosures«: Gemeindeland wurde eingezäunt und privat angeeignet.
Die Bauern, die vorher auf dem Land arbeiten konnten, standen nun draußen vor: Sie wurden von ihrem Acker vertrieben. Jahrhundertealte, teilweise kollektiv ausgeübte Gewohnheits- und Nutzungsrechte, die eine nicht vom Eigentum anderer eingeschränkte Produktion von Nahrung und Rohstoffen zum Überleben ermöglichten, wurden hinweggefegt. Von Landbesitzern oder Feudalherren, die vom Interesse motiviert waren, die Ackerfläche profitabel zu nutzen. Viele der Landlosen strömten in die Städte und suchten Arbeit, denn dort standen die neuen Fabriken. Das Proletariat entstand.
Unterm Strich war die Loslösung der Menschen von ihrem Land, nachdem Grund und Boden über Jahrtausende hinweg das zentrale Produktions- und Überlebensmittel aller Zeiten war, einer der größten Brüche der jüngeren Menschheitsgeschichte. Erstmals wurden alle Lebensbedingungen zur Ware, nicht mehr nur Güter, sondern auch Boden und Arbeit wurden handelbar. Ein kapitalistischer Markt entstand, mit Karl Polanyi könnte man von einer »Entbettung der Ökonomie aus der Gesellschaft« sprechen.
Die verschleierte Eigentumslosigkeit
Der Bauer verwandelte sich in den Arbeiter, befreit aus feudalen persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen und vertrieben von seinem Land, daher »frei« von Produktionsmitteln, also eigentumslos. Marx nannte das den »doppelt freien Arbeiter«: Er hat den Zugang zu den Mitteln seines bisherigen Überlebens verloren, er ist dadurch gezwungen, seine Arbeitskraft an jemanden zu verkaufen, der Produktionsmittel hat. Das gilt im Wesentlichen bis heute.
Im Kapitalismus gehören die Produktionsmittel vergleichsweise wenigen Menschen, der damit produzierte Reichtum entsteht zwar gesellschaftlich, angeeignet wird er aber privat. Das ist Privateigentum. Es tritt doppelt auf: ökonomisch und juristisch. Die juristische Form verschleiert die Eigentumslosigkeit an Produktionsmitteln: Die Beschäftigten dürfen ihre Arbeitskraft als freie Rechtssubjekte verkaufen, der Lohn ermöglicht ihnen, sich die von ihnen selbst produzierten Güter wieder zurückzukaufen, sie haben dann ein Eigentumsrecht daran und dürfen andere davon ausschließen, sie können etwas sparen, sie können auch als freie Willensträger einen Mietvertrag abschließen oder, wenn sie Glück, gut verdient oder geerbt haben, sogar eine Wohnung kaufen.
Auch Marx wusste, dass die abhängig Beschäftigten durch Lohnerhöhungen ihren »Konsumtionsfonds von Kleidern, Möbeln, und so weiter besser ausstatten und kleine Reservefonds von Geld bilden« können. Am grundsätzlichen hierarchischen Verhältnis zwischen jenen die Eigentum an Produktionsmitteln haben, und jenen, die es nicht haben, ändert das nichts.
Auf der juristischen Ebene treten sich die Menschen alle gleichermaßen mit einem exklusiven Rechtsanspruch gegenüber, sie sind potenziell eigentumsfähig, sie sind: rechtlich gleich, aber ökonomisch ungleich. Diese ökonomische Ungleichheit, sofern sie in soziales Elend führt oder zumindest nicht in eine ausreichende materielle, stabile Sicherheit mündet, findet dann aber, grade weil alle gleich scheinen, kaum eine andere Erklärung als jene der individuellen Schuld, des mangelnden Fleißes, des persönlichen Versagens, des Pechs.
Der Streit um Enteignung und Eigentum dreht sich in aller Regel nur um die juristische Gestalt des Eigentums – die ökonomische Seite und der Zusammenhang zwischen beidem bleiben verborgen. Die Effizienz nun, die dem Privateigentum zugeschrieben wird, die zu Wachstum und Wohlstand führt, soll daher rühren, dass die Menschen nur dann einen Anreiz zur Arbeit bekommen, wenn sie sagen können: Das Ergebnis der Arbeit gehört mir.
Dann werden sie angeregt, besser und sorgsamer zu produzieren, sie werden ein Interesse haben, ihr Eigentum zu vermehren. Das nennt man die Anreiztheorie des Eigentums. Sie ist nicht falsch. Nur: Die unmittelbaren Produzenten verfügen nicht über die Früchte ihrer Arbeit. Sie produzieren für eine fremde Person, mit fremden Produktionsmitteln, für einen Zweck, den sie nicht bestimmen können und der sich im Zweifel sogar gegen sie wendet. Sie verfügen nicht. Aber sie arbeiten trotzdem. Warum?
Der stumme Zwang
Es ist der »stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse«, der sie treibt und sie strengen sich an, denn im Hintergrund lauert die berühmte »Reservearmee«, mit stets jüngeren, willigeren, besser ausgebildeten, jedenfalls konkurrierenden Beschäftigten, sowie die Drohung, den Arbeitsplatz zu verlieren. Wer das »Anreiz« nennen mag. Es gibt nicht zufällig immer wieder neue Managementmethoden, die versuchen, die Motivation der Beschäftigten zu steigern, auch die berühmte Mitarbeiterbeteiligung resultiert aus solchen Erwägungen, es gibt ein ganzes Arsenal an Motivationsliteratur, was noch keinen einzigen Verfechter der Anreiztheorie des Privateigentums ins Grübeln gebracht hat.
Der Anreiz, das Eigentum zu vermehren, gilt für jene, die es haben. Im Kapitalismus sind es die Eigentümer der Produktionsmittel. Die Kapitalisten, die Anteilseigner, die Anleger, sie haben alle das Interesse daran, dass aus dem angelegten Kapital mehr Kapital wird. Profitmaximierung ist das Ziel und die Rendite, das sind die »Früchte der Arbeit«: gesellschaftlich produziert, privat angeeignet. Dieser spezifisch kapitalistische Anreiz, wenn man das so sagen kann, wird in einer Weise universalisiert, dass er gar zur Natur des Menschen avanciert und bis in die Frühgeschichte der Menschheit projiziert wird. Das wirkt.
Nicht nur der Anreiz, auch die berühmte Effizienz des Privateigentums ist eine spezifisch kapitalistische: Die Produktionsmittel sind dann effizient eingesetzt, wenn gemessen am vorgeschossenen Kapital mehr rauskommt, als reingesteckt wurde. Der Kapitalist steht dabei selbst in Abhängigkeit: Er muss nämlich, damit er »am Markt bleibt«, also bei Strafe des Untergangs, immerzu versuchen, besser und billiger zu sein als die Konkurrenz. Und das müssen alle.
Aus dieser kollektiven Logik entspinnt sich ein gegenüber den Belastungsgrenzen der Natur und der Arbeitskraft stummblinder Zwang zum Wachsen. Und das ist sie, die Effizienz des Privateigentums und sie erscheint als alle Menschen und alle Geschichte übergreifendes Moment.
Die kapitalistische Effizienz hat eine unhintergehbare Kehrseite, nämlich die Zerstörung der Quellen, von denen sie selbst lebt. Niemals zuvor in der Geschichte gab es eine solch aggressive Produktionspeitsche, die zwar in der Tat eine Masse an Waren ausspuckt und in einigen Regionen und Ländern der Welt für einen nicht unerheblichen materiellen Wohlstand gesorgt hat, all das aber im Zuge einer bis dahin nie gekannten selbstzerstörerischen Umwandlung und Ausbeutung von Naturstoffen und menschlicher Arbeitskraft.
Nach dem Bedürfnis, nicht nach Profit
Marx hat die historische Vertreibung der »unmittelbaren Produzenten« von ihren »Produktionsmitteln« beschrieben als eine Veränderung der Art und Weise, wie sich die Menschen arbeitsteilig Natur angeeignet haben, in welchen Herrschaftsverhältnissen dies ablief und zu welchem Zweck. Die abhängig Beschäftigten im Kapitalismus wieder zu Eigentümern der Produktionsmittel zu machen, hieße daher nicht, zurück aufs Land, sondern die Produktionsmittel einem anderen Zweck zu widmen als einem maßlosen Wachstumszwang bei gleichzeitiger Umverteilung von unten nach oben, mit anderen Worten:
Gesellschaftliche Produktion, in der gesellschaftlich, nicht privat, angeeignet wird, das heißt, jenseits von Herrschaftsverhältnissen: demokratisch. Die materiellen Bedürfnisse der Menschen, Sicherheit, Perspektive, disponible Zeit, gesunde Natur und so weiter wären Kriterium einer solchen neuen Produktion, sie wären dem Bedürfnis nach Profit und den Zwängen der Konkurrenz übergeordnet und nicht untergeordnet, so wie es heute die Regel ist.
Und Aristoteles? Seinerzeit war das Denken in Kategorien grenzenlosen Wachstums fremd. Effizient war nicht, aus Geld mehr Geld zu machen. »Effizient« war, eine friedliche Ordnung zu finden, in der geklärt ist, wer für was zuständig ist: »… wenn jeder Einzelne den Besitz persönlich als Eigentum hat, kann man ihn einerseits seinen Freunden zur Nutzung bereitstellen, andererseits aber auch den Besitz (anderer) nutzen, so als gehöre er der Allgemeinheit«. Das stelle man sich mal im Kapitalismus vor.
Erschienen in: OXI, Wirtschaft anders denken, Juli 2019, Seite 3