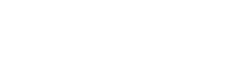Im Vorfeld der Marx-Jubiläen stehen MarxistInnen und Marx-Beschäftigte im Kampf gegen Windmühlen. Fast alle Medien, die was auf sich halten, haben den 150jährigen des Kapitals und den 200. Geburtstag seines Schöpfers auf dem Redaktionsplan. Ein Must have der Themenplanung. Meist im Feuilleton oder im Wirtschaftsressort widmen sich JournalistInnen oder GastautorInnen dem Denker, seinem Werk, seinen Thesen. Man kommt kaum nach.
Für Leute, denen mitunter unterstellt wird, sie seien ExpertInnen, kann das eine ganz schöne Zumutung sein. Man kennt sich halt wirklich aus. Das Leid des Expertentums. Wahrscheinlich ergeht es allen so, die sich intensiv mit etwas beschäftigen und in der journalistischen Widerspiegelung die Tiefenkenntnis ihres Themas vermissen. Kein Grund zum Wundern also, gar zum Ärgern. Aber ein Anlass, den Kampf gegen die Windmühlen mit Gelassenheit und Ausdauer zu führen. Eine Herausforderung, denn der Windmühlenkampf ist dadurch definiert, dass er „vergeblich gegen Zustände ankämpft, die sich nicht ändern lassen“ (aus dem Wictionary zitiert, welches die historischen Ursprünge dieser Redewendung erklärt, ein Kenner mag sich darüber die Haare raufen).
Unbeirrt soll an dieser Stelle eine weitere kleine Blüte der Marx-Rezeption in den Medien besprochen werden. In der Neuen Zürcher Zeitung erschien jüngst eine Kolumne über den Warenfetisch bei Marx mit dem schönen Titel: „Karl Marx und der Fetischcharakter des Autos“. Der Text steigt ein mit derzeit häufig kolportierten Behauptungen: „Karl Marx war ein weitblickender Denker; dennoch haben sich viele seiner Prophezeiungen als falsch erwiesen.“ Man kann bestreiten, dass die Ergebnisse des umfangreichen und über die Jahre sich gewandelt habenden Marx’schen Schaffens es rechtfertigen, ihm diese Vorhersagen zuzuschreiben. Oder um es mit Elmar Altvater deutlicher zu sagen, es ist „harter Tobak, der auch heute aus den journalistischen Pfeifen qualmt.“
Aufmerksam werden Marxberichterstattungs-Leidgeprüfte daher, wenn es wie in der oben zitierten Kolumne der NZZ weiter heißt: „In Marx‘ Hauptwerk von 1867, «Das Kapital», kommt indessen ein Phänomen zur Sprache, das heute mehr denn je Aktualität zu haben scheint.“ Der Autor meint damit den Warenfetisch und zitiert Marx mit der einschlägigen Stelle, dass eine Ware ein vertracktes Ding sei, „voller metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken“. Der Kolumnist erkennt darin eine Art Fetisch, der Dingen eine außerhalb ihrer selbst stehende obskure Eigenschaft zuschreibt.
Nach Marx, so glaubt der NZZ-Autor, ist es die Verselbständigung der Dinge, die dazu führe, „dass Menschen im Kapitalismus letztlich von den Produkten ihrer eigenen Arbeit beherrscht werden.“ Fetisch sei, so versteht er Karl Marx, wenn Produkte mit eigenem Leben ausgestattet sind. Er sieht dies in der heutigen Zeit auf die Spitze getrieben, was die Aktualität Marxens beweise und er nennt Smartphones und selbstfahrende Autos als Paradebeispiele für Produkte, die ein Eigenleben führen: „Namentlich in der Fahrzeugindustrie ist man überzeugt, dass Autos mehr als nur materielle Eigenschaften haben. «Ohne Herz wären wir nur Maschinen», lautet ein Alfa-Romeo-Slogan; bei Mazda spricht man von der «Seele der Bewegung»“. Auch die künstliche Intelligenz fällt kurzerhand in diese Fetischdefinition: „In anderen Technologiebereichen, etwa bei Computern, steht nicht die Seele, sondern die Intelligenz der Maschinen im Vordergrund.“ Und am Ende ist es dann laut NZZ nicht mehr die „Diktatur der Proletariats“, die als Schlachtruf zur heutigen Zeit passen würde, sondern: „Alle Macht den Konsumenten“.
Der Marx’sche Fetischcharakter hat gar nicht so viel mit der landläufigen Bestimmung dessen zu tun, was Fetisch ist. Marx kannte kurz gesprochen und zugespitzt drei Fetischformen: den Waren-, den Geld- und den Kapitalfetisch. Ihnen gemein ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse als dingliche Eigenschaften auftreten. So wird beispielsweise der Mehrwert, der im Rahmen eines Ausbeutungsverhältnisses entsteht und in der Gestalt des Profits auftritt, als originäre Frucht des Kapitals gesehen (Kapitalfetisch). Ein Unternehmer investiert Kapital, er kauft damit Arbeit, Produktionsmittel, Rohstoffe, lässt produzieren, erzielt im Idealfall damit Profit und Schwupps hat das investierte Kapital Gewinn „abgeworfen“, die dem zugrunde liegende Ausbeutung ist unsichtbar. Das Kapital erscheint als mit einer Eigenschaft ausgestattet, die dem Kapital selbst als quasi natürlich zukommt, die ihre Grundlage aber in ganz konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen hat – kein Hokuspokus.
Oder, um beim Warenfetisch zu bleiben: Nehmen wir eine Tomate, die verkauft werden soll. Sie ist rot, rund, saftig, hat Kerne und einen Tauschwert. Letzterer ist keine natürliche Eigenschaft der Tomate, er resultiert vielmehr aus unserer alltäglichen Praxis, ist Ergebnis bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse. Der Fetischcharakter besteht nun nicht darin, dass wir der Tomate die obskure Eigenschaft Wert zuschreiben, die sie eigentlich gar nicht hat und die wir uns nur dazu phantasieren würden, wie dem Holzstückchen die Eigenschaft, Träume vertreiben zu können. Der Fetischcharakter besteht darin, dass der Wert der Tomate zwar eine nicht-sinnliche Eigenschaft ist, aber eine, die in der kapitalistischen Gesellschaftsform durch eine spezifische alltägliche Praxis unbewusst ständig neu hervorgebracht wird, die real existiert, mit aller Wirkmacht, und der Tomate aber als etwas Natürliches im Sinne von „schon immer der Tomate Zugehöriges“ zugeschrieben wird.
Man kommt mit dem Marx’schen Fetischbegriff nicht zu demselben Ergebnis, wie der NZZ-Autor. Vielmehr bezeichnet Marx als Fetisch die falsche Vorstellung eines vom Menschen unabhängig existierenden ökonomischen Werts und ökonomischer Gesetze, denen wir uns alle unterwerfen, obwohl wir sie selbst produziert haben. Dass Autos eine Seele haben können, dass KonsumentInnen bestimmten Produkten Wirkungen zuschreiben oder Produkte bestimmte Wirkungen auf die KonsumentInnen tatsächlich ausüben, stimmt trotzdem. Es ist das Thema der Werbeindustrie. Nicht das von Marx.